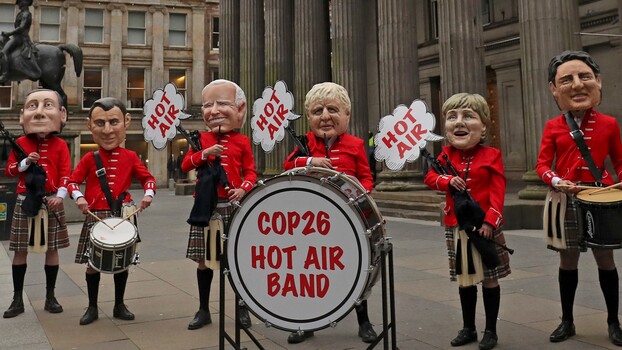
In Glasgow wird unter anderem darüber verhandelt, wie der Artikel 6 des Pariser Abkommens umgesetzt werden soll. Dahinter verbirgt sich der Rahmen für die Nachfolgeregelungen der so genannten Flexiblen Mechanismen des Kyoto-Protokolls, das 2020 auslief.
Was zunächst sehr technisch klingt (und es auch ist), hat enorme politische Sprengkraft. Denn die Bilanz dieser Instrumente - Joint Implementation (JI) und Clean Development Mechanism (CDM) - fällt sehr problematisch aus (zur Erklärung der Instrumente siehe Kasten). Selten führten sie zu der ursprünglich erwünschten Emissionsreduzierung – sie nährten vielmehr das Gefühl, dass Probleme nur verlagert und nicht gelöst wurden. Ein Nachfolgesystem könnte ähnliche Wirkungen haben.
Uwe Witt ist Referent Klimaschutz und Strukturwandel bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Katja Voigt ist Referatsleiterin für Internationale Politik und Nordamerika bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung sowie Referentin für Klimapolitik.
Ursprünglich sollten von Industriestaaten initiierte und finanzierte Klimaschutzprojekte im Globalen Süden (über CDM) oder in anderen, oft wirtschaftlich schwächeren Industriestaaten (über JI), den Klimaschutz insgesamt kostengünstiger machen. Sie zielten auf finanziell preiswert zu erschließende Minderungsoptionen ab, die es so in vielen westlichen Industriestaaten in dem Umfang nicht mehr gibt bzw. die als unwirtschaftlich gelten. Dabei sollte gleichzeitig die nachhaltige Entwicklung in den Staaten befördert werden. In der Bilanz haben diese Instrumente jedoch größtenteils versagt. Nicht nur führten viele dieser Projekte zu nicht zusätzlichen Emissionsminderungen über eine Entwicklung hinaus, die ohnehin stattgefunden hätte. Bei etlichen kam es auch zu Menschenrechtsverletzungen, Landraub und einer zusätzlichen Umweltbelastungen, etwa bei Staudamm-Großprojekten. Damit werden die bestehenden ungerechten Verhältnisse, die ihren Ursprung im Kolonialismus haben, auch in diesen Projekten fortgeführt.
Konkret konnten Emissions-Einsparungen in den sogenannten Gastländern zur Erfüllung von Minderungsverpflichtungen in den Käuferländern genutzt werden, etwa im Europäischen Emissionshandelssystem (ETS). Aus Sicht der globalen Emissionsentwicklung wäre dies also ein Null-Summen-Spiel gewesen, das Kosten spart. Dazu hätten die Klimaschutzprojekte, von denen dann Emissionsrechte in Höhe der Einsparungen übertragen wurden, allerdings zusätzlichen Klimaschutz liefern müssen – und dieser hätte über das hinausgehen müssen, was an Klimaschutz ohne die Projekte ohnehin geschehen wäre. Ist das nicht der Fall, und die zugekauften Emissionsrechte werden tatsächlich eingesetzt, kommt es zu globalen Mehremissionen. Die «Zusätzlichkeit» oder «Additionalität» war daher von Vornherein ein intransparentes Kriterium, das nahezu unmöglich abzuschätzen war.
Diese «graue Zone» im System wurde auch ausgenutzt. Denn in den Prozessen zur Projektgenehmigung, Registrierung und Verifizierung wurde vielfach getrickst, so dass jede Menge «faule Zertifikate» generiert wurden. Sie überschwemmten weltweit als Billig-Zertifikate existierende nationale oder multilaterale Emissionshandelsmärkte. In Europa kamen beispielsweise zwischen 2008 und 2020 auf diese Weise 1,6 Mrd. zusätzliche Emissionsrechte auf den Markt (was fast dem Emissionsbudget der ETS-Sektoren für ein ganzes Jahr entsprach) - die CO2-Preise fielen in der Folge ins Bodenlose. Die Wirkung des ETS auf die Energiewirtschaft und die Industrie in Europa tendierte gegen Null. Bis heute sind hunderte Millionen von ungenutzten Emissionsrechten auf den Konten von Unternehmen eine Bürde für das System. Sie werden nur schrittweise über verschiedene Korrektur-Instrumente abgebaut.
Mit dem Pariser Abkommen haben sich die Rahmenbedingungen für den Einsatz von marktbasierten Projektmechanismen etwas verändert. Zum einen, weil nun im Gegensatz zu Kyoto alle Staaten Emissionsziele haben. Daraus müsste tendenziell ein höheres Eigeninteresse der Gastländer erwachsen, nur Zertifikats-Übertragungen zuzulassen, die auf Projekten basieren, die wirklich zusätzliche Emissionsminderungen zur sonstigen Entwicklung erbringen. Schließlich wandert mit den Zertifikaten stets ein Teil ihrer Emissionsminderung in die Käuferländer ab. Zum anderen enthält Artikel 6 auch Formulierungen, die von den Nachfolge-Instrumenten einfordern, dass sie zusätzlich zu den nationalen Emissionsminderungen auch das globale Gesamtbudget der Emissionen verringern sollen. Mit dem ausschließlichen Null-Summenspiel - das es bisher auch nicht war - soll Schluss sein.
Doch die Sache ist komplizierter. Die Staaten interpretieren Artikel 6 unterschiedlich, ökonomische Interesse prallen aufeinander. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sich auch im Verhandlungsergebnis unter dem Pariser Abkommen Schlupflöcher öffnen. Strittig sind zudem Übergangsregeln für die Mechanismen aus der Kyoto-Welt in die Logik des Pariser Abkommens. Und wieder fragt man sich, warum Lösungen in einem zentralen Baustein weiterhin auf Marktlösungen basieren sollen, die bislang nicht funktioniert haben.
Die Europäische Union hat bereits im letzten Jahr beschlossen, ihr Klimaschutzziel für 2030 ohne den Kauf von Zertifikaten aus projektbasierten Mechanismen zu erreichen. Einige Länder außerhalb der EU wollen den Mechanismus jedoch gegebenenfalls nutzen.
Ob und wie diese Mechanismen künftig eine Rolle spielen werden haben wir Lambert Schneider vom Öko-Institut gefragt. Er verhandelt in Glasgow für die EU die Umsetzungsregeln des Artikel 6 mit aus, der den Rahmen für die Nachfolge der internationalen Projektmechanismen setzt.