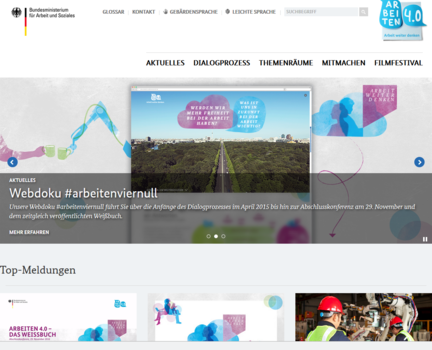Mit ihrem Ende November 2016 vorgelegten »Weißbuch Arbeiten 4.0« findet ein anderthalb Jahre währender, vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) organisierter, »Dialogprozess« zur Erstellung eines Leitbildes für die Arbeitswelt der Zukunft seinen vorläufigen Abschluss. Erklärtes Ziel des BMAS war und ist dabei die Vorbereitung eines »neuen gesellschaftlichen Flexibilitätskompromisses«. Jenseits blumiger Projektionen auf künftige Chancen für den Wirtschaftsstandort Deutschland und neue Freiheiten für die »work-life-balance« der Beschäftigten ist dabei eine klare Agenda erkennbar: Durch Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen soll künftig vom Arbeitsrecht, vor allem vom Arbeitszeitgesetz, abgewichen werden können – und zwar nach unten.
| Eine gekürzte Fassung dieses Textes ist als Standpunkte-Papier erschienen. |
»Flexibilität«, so Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) bei der Vorstellung ihres »Weißbuches Arbeiten 4.0« Ende November in Berlin, »wird im 21. Jahrhundert wohl das Konfliktthema schlechthin.« Es spricht einiges dafür, dass die Ministerin mit dieser lapidaren Feststellung richtig liegt.
Natürlich ist das nicht ganz neu. »Flexibilität« oder »Flexibilisierung« war ein ideologischer Kampfbegriff von Anfang an, und diese Anfänge liegen in Deutschland in der 1980er Jahren. Die »Flexibilisierung der Arbeitszeit« wurde damals als strategische Antwort der Unternehmen auf den gewerkschaftlichen Vormarschs bei der Verkürzung der Arbeitszeiten entwickelt und hat sich in dieser Hinsicht vor allem seit Mitte der 1990er Jahre als wahres Erfolgsmodell erwiesen: Trotz tariflicher Arbeitszeitverkürzungen steigen die realen Arbeitszeiten seither wieder an. Exemplarisch für diese Entwicklung ist, dass im Bindungsbereich von IG-Metall-Tarifverträgen heute real 40 Stunden in der Woche gearbeitet wird – unabhängig davon, ob die tarifliche Wochenarbeitszeit bei 35 wie im Westen oder 38 Stunden im Osten liegt. Und das ist der geregelte Bereich. Bundesweit unterliegt aber nur noch jeder zweite Arbeitsplatz irgendeiner Form von Tarifbindung, im Osten Deutschlands sind tarifgebundene Arbeitsplätze bereits die Ausnahme. [1]
In einem weiteren Sinne umfasst der Flexibilisierungsdiskurs über das Feld der Arbeitszeit hinaus auch das Arbeitsvertragsrecht, den Arbeits- und Gesundheitsschutz und letztlich das Arbeitsrecht insgesamt. Im Prinzip geht es um die Lockerung rechtlicher Vorgaben schlechthin, die die Verfügbarkeit menschlicher Arbeitskraft einschränken. Wie es die Daimler AG in ihrer Stellungnahme zum »Arbeiten 4.0«-Prozess formuliert: »Flexible Beschäftigungsformen wie Zeitarbeit, befristete Arbeitsverhältnisse, Teilzeit und selbstständige Tätigkeiten ermöglichen den Unternehmen die notwendige Anpassungsfähigkeit in Bezug auf ein volatiles Umfeld.«[2] »Flexibilisierung« ist in diesem Sinne ein Synonym für die Deregulierung des Arbeitsmarktes.
Auch wenn etwa im Zusammenhang mit den anderen »Arbeiten 4.0«-Themen wie »Plattformökonomie« und »Crowdwork« der Flexibilitätsbegriff in der jüngeren Vergangenheit gelegentlich in diesem weiteren Sinne gebraucht wird, fokussiert sich die Debatte gegenwärtig doch auf die Frage des Arbeitszeitregimes.
Ergebnisoffener Dialog?
»Mit ›Arbeiten 4.0‹ werfen wir einen Blick in die Arbeitswelt von heute, aber auch von morgen und übermorgen«[3], schrieb Nahles im Frühjahr 2015 in einem »Grünbuch«, das den Prozess eröffnete. Man wolle »einen breiten Dialog darüber in Gang setzen, wie wir arbeiten wollen und welche Gestaltungschancen es für Unternehmen, Beschäftigte, Sozialpartner und Politik gibt.« Erklärtes Ziel sei es, »einen neuen sozialen Kompromiss« zu entwickeln, »der Arbeitgebern wie Arbeitnehmern nützt. Etwa indem wir gemeinsam mit den Sozialpartnern Wege finden, wie Beschäftigte ihre jeweiligen Arbeitszeitwünsche auch umsetzen können. Indem wir einen Ausgleich herstellen zwischen den Flexibilitätsanforderungen der Unternehmen und den Bedürfnissen der Beschäftigten.«[4]
Die Notwendigkeit, »die Interessen von Unternehmen und Beschäftigten in einem neuen Flexibilitätskompromiss auszutarieren«[5], ergibt sich in der Argumentation des »Arbeiten 4.0«-Diskurses geradezu zwingend aus der Globalisierung der Wirtschaft und technologischen Veränderungen, die wahlweise mit den Begriffen »Digitalisierung« oder »Industrie 4.0« beschrieben werden. Als weitere Treiber werden demografische Entwicklung und der »kulturelle Wandel« von Lebensstilen und Werten benannt.[6]
Konkrete Ideen, wie der ominöse »neuen Flexibilitätskompromisses« wohl aussehen könnte, fand man im »Grünbuch« kaum. Auch das gehört wohl zur Inszenierung »ergebnisoffener Dialogprozesse«. Erst im Laufe des Jahres 2016 verdichtete sich in der öffentlichen Wahrnehmung, worauf es hinauslief: Die Schutzstandards des Arbeitszeitgesetzes sollen künftig – über die schon bestehenden recht umfangreichen Möglichkeiten hinaus – grundsätzlich durch Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen unterlaufen werden können. »Nicht immer entspricht das Korsett des Arbeitszeitrechts den spezifischen Bedürfnissen bestimmter Betriebe oder Beschäftigter«, so die Ministerin in einem Gastbeitrag für die FAZ am 21. Juni 2016. »Hier könnte der gesetzliche Rahmen etwas erweitert werden, unter der Voraussetzung ›ausgehandelter Flexibilität‹, die einen Tarifvertrag und eine Betriebsvereinbarung voraussetzt.«[7] Im anderthalb Jahre später veröffentlichten »Weißbuch« heißt es nun, man wolle künftig »ein Mehr an Regelungsmöglichkeiten an das Bestehen von Tarifverträgen knüpfen«.[8]
Als Referenzmodell wird dabei eine Konzernbetriebsvereinbarung von Bosch zur Mobilarbeit angeführt. Hier ist seit 2014 geregelt, dass Beschäftigte, deren Arbeitsaufgabe dies sachlich zulässt, einen Rechtsanspruch haben, gelegentlich zu Hause zu arbeiten, sofern sie es wünschen. Diese Mobilarbeit ist grundsätzlich freiwillig und kann nicht angeordnet werden. Beschäftigte entscheiden, wann sie erreichbar sind und hinterlassen die Zeiten im Büro. Arbeit an Sonn- und Feiertagen ist verboten. Die Arbeitszeiten werden durch die Beschäftigten selbständig erfasst und als normale Arbeitszeit vergütet. Zuschläge für genehmigungspflichtige Mehrarbeit werden bezahlt, nicht aber für Spät- oder Nachtarbeit, sofern diese nicht explizit angeordnet wird.[9]
Offenbar kommt die Regelung bei den Beschäftigten gut an, während sie für viele Führungskräfte eher gewöhnungsbedürftig ist. Man kann sie durchaus als Beispiel für eine gelungene betriebliche Regelung diskutieren, aus der sich lernen lässt. Ob sie als Blaupause für neue gesetzliche Standards dienen kann, steht auf einem anderen Blatt. Deutschland ist eben nicht Bosch: Was im baden-württembergischen Technologiekonzern mit seiner hohen tariflichen Absicherung, ausgeprägten Mitbestimmungstradition und gewerkschaftlich gut organisierten Belegschaft funktioniert, kann andernorts, wo Tarifbindung und betriebliche Mitbestimmung längst fragil geworden sind, wo Gewerkschaften schwach und Betriebsräte allenfalls Erfüllungsgehilfen von Geschäftsführungen sind, einen Dammbruch bei elementaren Schutzbestimmungen auslösen.
Tatsächlich zeigt sich hier die gleiche Handschrift wie schon bei der Novellierung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes: So wie dort die Höchstüberlassungsdauer von Leihwerkern ausgeweitet oder der Zeitpunkt, ab dem Anspruch auf »Equal Pay« besteht, über die gesetzliche Obergrenze hinausgezögert werden kann,[10] sollen nun Mindeststandards bei Arbeits-, Pausen- und Ruhezeiten gelockert werden. Schon 2017 soll es mit einer zweijährigen »Experimentierphase« losgehen – natürlich: »wissenschaftlich begleitet, tarifvertraglich abgesichert«.[11] Gesetzliche Schutzrechte für Beschäftigte durch Tarifverträge prinzipiell aushebelbar zu machen, und das dann auch noch als Stärkung von Tarifautonomie und Mitbestimmung zu verkaufen, scheint zum Markenzeichen der Amtszeit von Andrea Nahles als Bundesarbeitsministerin zu werden.[12]
Mythos technologischer Sachzwang
Die Fragestellungen des »Grünbuches« folgen einer Erzählung, nach der die »Digitalisierung der Arbeit«, mitunter auch als »vierte industrielle Revolution« (»Industrie 4.0«) bezeichnet, durch enorme »Chancen« für Unternehmen, Beschäftigte und den Wirtschaftsstandort Deutschland schlechthin gekennzeichnet ist, die man nicht durch das Festhalten am derzeitigen Arbeitszeitregime verspielen dürfe. »Der starre Acht-Stunden-Tag passt nicht mehr ins digitale Zeitalter, wir wollen mehr Beweglichkeit«[13], erklärte BDA-Präsident Ingo Kramer im Dezember 2015.
Zentrale Forderung der Arbeitgeber ist die Abschaffung der Obergrenzen für die tägliche Arbeitszeit im deutschen Arbeitszeitgesetz – stattdessen soll künftig nur noch ein wöchentliches Limit von 48 Stunden gelten. Darüber hinaus soll die vorgeschriebene Ruhezeit von elf Stunden zwischen zwei Arbeitstagen abgeschafft oder mindestens aufgeweicht werden. Generelle Linie ist die Lockerung gesetzlicher Beschränkungen und die Schwächung betrieblicher Mitbestimmung zugunsten von individuellen Vereinbarungen mit einzelnen Beschäftigten.[14]
Bei allen Nuancen in der Argumentation leiten sowohl Unternehmer als auch BMAS die Notwendigkeit einer weiteren Flexibilisierung des Arbeitszeitregimes unmittelbar aus der Digitalisierung ab. Doch ob für den behaupteten Flexibilisierungsbedarf wirklich technische Gründe ursächlich sind, darf bezweifelt werden. Die vermeintliche Kausalkette »Digitalisierung erfordert Flexibilisierung« wird nirgends schlüssig begründet, sondern einfach als Selbstverständlichkeit in den Raum gestellt.
Technologische oder prozesstechnische Gründe für Abweichungen vom Normalarbeitstag sind ein altes Phänomen: Damit er morgens frische Brötchen verkaufen kann, muss der Bäcker nachts in der Backstube stehen. Hochöfen im Stahlwerk dürfen während des kompletten Verhüttungsvorgangs nicht erlöschen und müssen über mehrere Tage rund um die Uhr mit Erz und Koks beschickt werden, was ohne Schichtbetrieb nicht zu machen ist. Es ist nicht erkennbar, wo der Einsatz von Bürocomputern, Internet, mobilen Endgeräten, RFID-Chips oder 3-D-Druckern etwas Vergleichbares erfordern würde. Die Motive zur Flexibilisierung und Verlängerung von Arbeitszeiten im Zuge der Digitalisierung sind gerade nicht technischer, sondern betriebswirtschaftlicher Natur: Damit sich die hohen Investitionen rentieren, sollen teure Maschinen und Anlagen möglichst lange laufen. Beispielhaft hierfür stehen die Ausnahmegenehmigungen für die Einführung regulärer Zwölf-Stunden-Schichten in der ostdeutschen Solarindustrie, wie sie vor wenigen Jahren in der inzwischen weitgehend unter internationalem Konkurrenzdruck zusammengebrochenen Branche gang und gäbe waren. Die Begründung für diese Ausnahmen, wie sie etwa das Brandenburgische Arbeitsministerium 2012 auf Nachfrage gab, liest sich stellenweise wie ein Working Paper für den »Arbeiten 4.0«-Diskurs: (angebliche) technologische Notwendigkeit plus (vermeintlicher) Freiheitsgewinn für die Beschäftigten.[15]
Entgrenzung von Arbeit
Internet, Cloudspeicher und mobile Endgeräte schaffen für bestimmte Berufsgruppen neue Möglichkeiten der Entkoppelung der räumlichen und daraus folgend auch der weiteren zeitlichen Entgrenzung von Arbeit. Ein größerer Teil der üblichen Tätigkeiten in Bereichen wie Vertrieb, Verwaltung und Entwicklung kann heute auch außerhalb des klassischen Betriebs oder der Dienststelle erledigt werden – ob zu Hause im »Home Office« oder beispielsweise während einer Bahnfahrt. Für die Mehrzahl der Arbeitsplätze in Deutschland gilt dies jedoch bislang nicht. Nach Untersuchungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) gaben 2014 rund 60 Prozent aller abhängig Beschäftigten an, »dass bei ihrer Tätigkeit an Heimarbeit nicht zu denken wäre«. Immerhin: 40 Prozent hielten sie für »denkbar«. Tatsächlich nutzten sie jedoch nur zwölf Prozent »überwiegend oder gelegentlich«, nur ein verschwindend kleiner Teil arbeitete ausschließlich zu Hause. Nicht überraschend gibt es große Unterschiede zwischen verschiedenen Berufen und Branchen. Im privaten Finanzdienstleistungssektor ist das Modell sehr verbreitet, in der Land- und Bauwirtschaft dagegen gibt es nur wenige Arbeitsplätze, die dafür überhaupt geeignet sind. Zum Teil hat das Phänomen auch nichts mit der Digitalisierung zu tun, wie etwa bei Lehrern und Lehrerinnen, die ihre Unterrichtsvorbereitungen üblicherweise schon immer zu Hause machen. Deutlich wird beim DIW aber auch: Prinzipiell würde eine Mehrheit der Beschäftigten – nämlich zwei Drittel derer, bei denen dies der Charakter des Arbeitsplatzes im Prinzip erlaubt – gern gelegentlich von der Möglichkeit der Heim- oder Mobilarbeit Gebrauch machen. In den meisten Fällen scheitert dieser Wunsch an den Arbeitgebern.[16]
Ob die Möglichkeit der (teilweisen) räumlichen Entkoppelung der Arbeit von der Betriebsstätte für die Beschäftigten in der Praxis eher einen Zugewinn oder Verlust von Freiheit bedeutet, ist aber keine technische Frage. Es ist eine Frage von Aushandlungsprozessen, die auf verschiedenen Ebenen stattfinden können: Auf der politisch-gesellschaftlichen, konkret etwa der gesetzgeberischen, auf der Ebene von Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen oder letztlich individuell zwischen dem oder der einzelnen Beschäftigten und dem Unternehmer. Spätestens an dieser Stelle sollte klar sein, dass diese Aushandlung kein herrschaftsfreier Diskurs ist, sondern in einem Kraftfeld gesellschaftlicher Machtverhältnisse stattfindet, in dem die Ressourcen sehr ungleich verteilt sind.
Was unter dem Schlagwort »Zeitsouveränität« als Fortschritt verkauft wird, kann sich so schnell ins genaue Gegenteil verkehren: »Heimarbeiter kommen oft auf weit überdurchschnittlich lange Arbeitszeiten, und nicht selten leisten sie unbezahlte Mehrarbeit«, schreibt DIW-Forscher Karl Brenke. Dass geleistete Mehrarbeit nicht erfasst, vergütet oder durch Freizeitausgleich abgegolten wird, ist bei der Heim- oder Mobilarbeit demnach die Regel.[17] Doch das Ausufern von Arbeitszeiten und das Anwachsen unbezahlter Überstunden ist nicht auf diesen Bereich beschränkt, sondern eine verbreitete Erfahrung, die das Gros der Beschäftigten teilt. Nach Erhebungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit hat 2015 jeder und jede abhängig Beschäftigte im Schnitt 46,8 Stunden länger gearbeitet als vertraglich vereinbart. Mehr als die Hälfte dieser Überstunden wurde nicht bezahlt: Laut IAB haben die Beschäftigten 2015 den Unternehmen ein Arbeitsvolumen von 997,1 Millionen Stunden geschenkt.[18] Dies entspricht einer Lohnsumme von rund 15 Milliarden Euro.
Und auch die Flexibilität erweist sich in der Praxis als eher einseitige Angelegenheit. In der Beschäftigtenumfrage der IG Metall von 2013 gaben fast 30 Prozent der Befragten an, ihre täglichen Arbeitszeiten würden sich »häufig oder ständig« kurzfristig auf Anforderung des Unternehmens ändern. Bei den hochqualifizierten kaufmännischen Angestellten und Ingenieuren war sogar fast jeder Zweite (46 Prozent) betroffen. 22 Prozent der Befragten gaben an, ständig oder oft außerhalb der regulären Arbeitszeit zu arbeiten.[19]
Elemente eines Gegenentwurfs
Bei allen Unterschieden zwischen den Positionen der Unternehmer und den Intentionen des SPD-geführten Arbeitsministeriums – es handelt sich um Varianten ein und desselben Flexibilisierungsdiskurses, der hier mit verteilten Rollen präsentiert wird. Alles in allem weist er alle Merkmale professionellen Agenda-Buildings auf.[20] Weit davon entfernt, einen ergebnisoffenen Dialog zur Gestaltung der Arbeitswelt von morgen einzuleiten, hat die Bundesregierung, wie es der Arbeitsrechtsexperte Rolf Geffken formuliert, »einen ideologischen Generalangriff auf das klassische Verständnis vom Arbeitsrecht als einem Schutzrecht für Arbeitnehmer gestartet«.[21]
Ein gesellschaftlicher Gegenentwurf, der eine klassenpolitische Perspektive der abhängig Beschäftigten einnehmen und es womöglich mit der Präsenz des vorherrschenden Diskurses aufnehmen könnte, ist nicht in Sicht. Dennoch gibt es Elemente eines solchen, auch wenn sie unverbunden und teilweise in widersprüchliche politische Strategien verwoben sind.
So sind die Positionierungen der Gewerkschaften im »Arbeiten 4.0«-Prozess durchaus ambivalent. Tenor ist allgemein, dass Aufweichungen des Arbeitszeitrechts zurückgewiesen werden. Argumentativ wird dabei ins Feld geführt, dass »der Arbeitsmarkt in Deutschland bereits in hohem Maße von flexiblen Arbeitszeiten geprägt ist«[22], dies für die Beschäftigten aber in der Regel nicht zu mehr Arbeitszeitsouveränität, sondern einer Zunahme atypischer Arbeitszeiten geführt habe. Zugleich wird die Initiative des BMAS grundsätzlich begrüßt.[23] Immerhin wird man von der Regierung zum Dialog eingeladen – es könnte auch schlimmer kommen. Darüber hinaus sind die Interessenlagen heterogen: In den gut organisierten und mitbestimmungsgeprägten Kernbereichen der IG Metall (siehe Bosch) kann man mit den angestrebten Änderungen besser leben als im von Prekarität und Niedriglöhnen geprägten privaten Dienstleistungssektor.
So ist die Situation: Die einen haben eine strategische Agenda und die anderen fühlen sich nicht ganz wohl dabei. Das ist im Grunde keine sehr ermutigende Ausgangslage. Ähnlich ernüchternd ist, dass die naheliegendste Folgerung aus der Digitalisierung – das Potenzial für eine deutliche Arbeitszeitverkürzung – praktisch überhaupt nicht thematisiert wird. So ungewiss die konkrete künftige Entwicklung der Technik bleiben muss, eins ist sicher: Sie wird ungeheure Produktivitätszuwächse mit sich bringen. Das zeigt die bisherige Erfahrung, seit der Prozess in den 1980er Jahren mit der Einführung von Bürocomputern und Industrierobotern begann. Bemerkenswerterweise ist das ein Punkt, der in der Debatte praktisch nicht oder allenfalls an den Rändern vorkommt. War Arbeitszeitverkürzung in den 80er Jahren noch die gewerkschaftliche Antwort schlechthin auf die beginnende Digitalisierung, ist das Thema inzwischen weitgehend tabuisiert. »Eine Soundsoviel-Stunden-Woche ist heute für alle Beteiligten nicht mehr das Thema«, konnte die Arbeitsministerin bei der Vorstellung des Weißbuches konstatieren, ohne Widerspruch befürchten zu müssen.
Ganz offensichtlich wirken hier historische Traumatisierungen fort. Der IG Metall, die nicht nur in den 80ern, sondern das ganze 20. Jahrhundert in Deutschland ein Vorreiter gewerkschaftlich erstrittener Arbeitszeitverkürzungen war, sitzt ihre Niederlage beim Streik für die 35-Stunden-Woche in Ostdeutschland 2004 immer noch erkennbar in den Knochen. Der Arbeitskampf war damals an zwei Hindernissen gescheitert, mit denen die Organisation völlig überfordert war. Zum einen hatte sie während der gesamten Auseinandersetzung praktisch den kompletten Medienapparat gegen sich, wofür dieser wiederum die Rückendeckung der rot-grünen Koalition hatte. Das hätte im Verständnis der IG Metall-Führung nicht passieren dürfen, handelte sich doch um »ihre« Regierung. Entscheidend für den Zusammenbruch des Arbeitskampfes war aber letztendlich die Entsolidarisierung der wichtigsten Betriebsräte der großen Automobilkonzerne, die auf einen Abbruch des Streiks drängten, als er gerade anfing, durch Lieferengpässe Wirkung in den westdeutschen Autofabriken zu zeigen. Beide Probleme könnten in einer vergleichbaren Situation jederzeit wieder auftreten.
Anders bei ver.di: Im heutigen Organisationsbereich der Dienstleistungsgewerkschaft waren es in den 80er Jahren vor allem die in der IG Druck und Papier organisierten Drucker, die eine Protagonistenrolle im Kampf für die 35-Stunden-Woche spielten. Sie sind nun gerade beispielhaft für eine Branche, deren kampfstärkste Sektoren durch die Digitalisierung der letzten Jahrzehnte buchstäblich eliminiert wurden.
Dennoch gibt es sowohl bei ver.di wie auch IG Metall Ansätze einer eigenen arbeitszeitpolitischen Offensive, was ein Novum nach vielen Jahren Sprachlosigkeit auf diesem Gebiet ist und vor dem Hintergrund der oben geschilderten historischen Traumatisierungen gar nicht hoch genug bewertet werden kann.[24] So startete die IG Metall im Sommer 2016 ihre Kampagne »Mein Leben – meine Zeit«. Erstmals seit 2004 wird hier das Thema Arbeitszeit wieder systematisch mit einer breit angelegten Kampagne aufgegriffen. Als Kernziele formuliert die Organisation darin etwa den Stopp von unbezahlter Mehrarbeit und des »Verfalls« geleisteter Arbeitszeit. Für den Bereich der Mobil- oder Heimarbeit will die Organisation einerseits einen Rechtsanspruch der Beschäftigten, den der Arbeitgeber nur in begründeten Fällen ablehnen kann. Arbeitszeit soll dabei grundsätzlich erfasst und regulär bezahlt werden. Zugleich will die IG Metall, dass niemand gegen seinen Willen zur Mobilarbeit verpflichtet werden kann und Beschäftigte grundsätzlich ein »Recht auf Nichterreichbarkeit« haben. Weitere Kernthemen sind »lebensphasenorientierte Arbeitszeitmodelle«, in denen Beschäftigte Anspruch auf vorübergehende Arbeitszeitverkürzung bei garantiertem Rückkehrrecht zu einer Vollzeittätigkeit haben sollen und der Ausbau der bereits in der Tarifrunde 2015 eingeführten Bildungsteilzeit mit teilweisem Lohnausgleich.[25]
Ungefähr zeitgleich hat ver.di die arbeitszeitpolitische Debatte wieder aufgenommen, auch wenn dort noch keine Kampagne in Sicht ist. 2015 hat die Tarifpolitische Grundsatzabteilung ein Konzept für eine künftige ver.di-Arbeitszeitpolitik vorgelegt. So wie die Beschäftigtenstruktur im ver.di-Organisationsbereich eine andere ist als bei der IG Metall, setzt das Papier auch andere Akzente. Kernforderung ist die nach einer zusätzlichen »Verfügungszeit« von 14 freien Tagen, die jeder und jede Beschäftigte im Jahr bekommen soll. Die dahinterstehende Idee war, eine Forderung zu finden, die für Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigte gleichermaßen attraktiv und mobilisierungsfähig sein könnte. In Verbindung mit der Idee der Verfügungszeit wird das Leitbild einer »kurzen Vollzeit« ins Spiel gebracht – eine Formulierung, die sich auch im Kontext der IG Metall in letzter Zeit häufiger findet.[26]
Eine vielversprechende Strategie, die ursprünglich aus dem Bereich von ver.di kommt, ist inzwischen auch in der IG-Metall-Kampagne aufgegriffen worden: Die Verknüpfung von Arbeitszeit, Arbeitsverdichtung und Personalbemessung. Im Frühjahr 2016 hat ver.di am Berliner Universitätsklinikum Charité den bundesweit ersten Tarifvertrag zur Personalmindestbesetzung im Gesundheitswesen durchsetzen können. Vorausgegangen war ein jahrelanger Kampf der Charité-Beschäftigten. Bemerkenswert ist auch, dass die Initiative von den gewerkschaftlich organisierten Charité-Beschäftigten ausging und von der ver.di-Führung lange nicht unterstützt wurde. Am Ende war sie dennoch erfolgreich.
Auch die LINKE im Bundestag meldete sich im Juni 2016 mit einem Positionspapier zum »Arbeiten 4.0«-Prozess. Die »Digitalisierung« werde »als Hebel angesetzt, um vor dem Hintergrund eines neuen Rationalisierungsprozesses eine umfangreiche Deregulierung von Arbeitnehmer*innenrechten durchzusetzen«, heißt es im analytischen Teil. Damit sich der technologische Fortschritt aber tatsächlich auch zum Vorteil der Beschäftigten auswirken könne, seien »konsequente Regulierungen auf gesetzlicher Ebene unabdingbar, die es nicht zuletzt braucht, damit es Beschäftigte auch auf tariflicher Ebene leichter haben, ihre Interessen auszuhandeln«. Als einzige politische Partei will die LINKE eine Reduzierung der gesetzlichen Höchstarbeitszeit, ein gesetzliches Recht auf Nichterreichbarkeit und eine Ausweitung der Mitbestimmungsmöglichkeiten bei der Lage und Verteilung der Arbeitszeit sowie der Personalausstattung. Schließlich fordert die Partei eine »effektive Anti-Stress-Verordnung als Bremse gegen Dauerstress, Burn-Out und Arbeit auf Abruf«.[27]
All diese Initiativen unterscheiden sich sowohl hinsichtlich ihrer Inhalte als auch ihrer praktisch-politischen Funktion, dennoch sind Schnittmengen unverkennbar. Wünschenswert und sinnvoll wäre auf jeden Fall, die Diskussion der damit gemachten und noch zu machenden Erfahrungen überall dort zu befördern, wo sich in den kommenden Jahren die reale Auseinandersetzung um die Neugestaltung des Arbeitszeitregimes entfalten wird. Das sind vor allem die Betriebe, aber in weiterem Sinne auch Kommunikationsräume wie die Gewerkschaften selbst, ihre Bildungseinrichtungen, Parlamente, Medien, die Öffentlichkeit schlechthin. Entscheidend wird sein, ob gewerkschaftliche und linke Arbeitszeitforderungen eine Bewegungsdynamik entfalten können oder nur eine Randnotiz zur professionell inszenierten Simulation eines gesellschaftlichen Dialogs bleiben werden. Die Frage ist offen, aber die Antwort immerhin beeinflussbar. Um aufs eingangs zitierte Bonmot der Bundesarbeitsministerin zurückzukommen: »Flexibilität wird im 21. Jahrhundert wohl das Konfliktthema schlechthin.« Möge sie damit recht behalten.
[1] IAB, Aktuelle Daten und Indikatoren, Tarifbindung der Beschäftigten, 01.06.2016
[2] Weißbuch »Arbeiten 4.0«, S. 26
[3] Grünbuch »Arbeiten 4.0«, BMAS 2015, S. 3
[4] Grünbuch »Arbeiten 4.0«, S. 9
[5] Grünbuch »Arbeiten 4.0«, S. 70
[6] Weißbuch »Arbeiten 4.0«, BMAS 2016, S. 18 ff.
[7] Andrea Nahles, »Wir brauchen einen neuen sozialen Kompromiss«, FAZ, 21.06.2016
[8] Weißbuch »Arbeiten 4.0«, S. 11
[9] Betriebsvereinbarung »mobiles Arbeiten« bei Bosch (IG Metall-Pressemitteilung)
[10] Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und anderer Gesetze (Referentenentwurf des BMAS vom 16.04.2016)
[11] »Wer tariflich gebunden ist, wird privilegiert«, Andrea Nahles im Interview mit der FAZ, 19.11.2016
[12] Die Möglichkeit durch Tarifvertrag von bestimmten gesetzlichen Normen abzuweichen, wird in der Rechtswissenschaft als »Tarifdispositivität« bezeichnet. Arbeitsrechtsexperten warnen seit Jahren, dass sich das Modell »zunehmend zu einem Instrument zur Reduzierung gesetzlicher Schutzstandards« entwickelt. M. Klauk, M.Schlachter: »Tarifdispositivität - eine zeitgemäße Regelung?«, in Arbeit und Recht, 09/2010, S. 354
[13] »Auch mal zwölf Stunden arbeiten«, Interview mit Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer, Rheinische Post, 19.12.2015
[14] »Arbeitswelt 4.0 – Chancen nutzen, Herausforderungen meistern, Positionen der BDA zum Grünbuch »Arbeiten 4.0« des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, Nov. 2015
[15] »Verlängerte Arbeitszeiten widersprechen nicht grundsätzlich dem Leitbild ›Guter Arbeit‹. Es kommt vielmehr auf die gegebenen Rahmenbedingungen (Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheitsschutz, Einverständnis der Beschäftigten, Regelungen zum Zeit- und Lohnausgleich) (…) an. So ist die im Arbeitszeitgesetz enthaltene Möglichkeit zur Genehmigung von 12-Stunden-Schichten für Betriebe, in denen aus technologischen Gründen ein kontinuierlicher Produktionsprozess erforderlich ist, an die Bedingung gebunden, dass sich zusätzliche Freischichten als ein Gewinn für die Beschäftigten ergeben müssen. Würden die 12h-Schichten nicht genehmigt, müsste der kontinuierliche Produktionsprozess in einem 3x 8 h –Schichtsystem erfolgen – dies würde für die Beschäftigten eine häufigere Anwesenheit im Betrieb/häufigere Anfahrten pro Woche bedeuten.« (Antwort des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie, Land Brandenburg, auf eine Rechercheanfrage des Autors, 14.06.2012)
[16] Brenke, Karl (2016): Home Office: Möglichkeiten werden bei weitem nicht ausgeschöpft. DIW-Wochenbericht 5/2016, S. 95–105
[17] Brenke, Karl (2016): Home Office, S. 102
[18] IAB-Kurzbericht 06/2016
[19] IG Metall Beschäftigtenbefragung. Analyse der Ergebnisse, Frankfurt a. M. 2013
[20] »Dass wir im Jahr 2015 fast in jeder gesellschaftlichen Sphäre von Industrie 4.0 reden, ist nicht die kausale Folge eines realen Stands technischer Entwicklungen, sondern diskursanalytisch betrachtet ein Fall professionellen agenda-buildings.« Sabine Pfeiffer, Der Diskurs um Industrie 4.0: Akteure, Interessen und Dynamik
[21] Rolf Geffken, Arbeit 4.0 - Arbeitsrecht in Gefahr. RAT & TAT Info Nr. 249, 20.07.2016
[22] Stellungnahme des DGB zum Grünbuch »Arbeiten 4.0«, 17.11.2015
[23] Vgl. ver.di-Stellungnahme zum Grünbuch »Arbeiten 4.0.«, 19.10.2015 und https://www.igmetall.de/fortschrittsdialog-arbeiten-4-0-16097.htm
[24] Vgl. dazu auch die entsprechenden Beiträge in Detje, Richard/Sybille Stamm/Florian Wilde (Hrsg.): Kämpfe um Zeit. Bausteine für eine neue (arbeits-)zeitpolitische Offensive, RLS Manuskripte Neue Folge 10, Berlin 2014.
[25] Mein Leben – meine Zeit. Die Arbeitszeitkampagne der IG Metall, Frankfurt a. M. 2016
[26] »Wir wollen raus aus der Frontstellung«, Interview mit Jörg Wiedemuth, Magazin Mitbestimmung, 06/2015
[27] Stellungnahme der Abgeordneten Klaus Ernst, Sabine Zimmermann, Matthias W. Birkwald, Herbert Behrens, Jutta Krellmann, Susanna Karawanskij, Harald Weinberg, Azize Tank zum Grünbuch Arbeiten 4.0 des BMAS, 8. Juni 2016