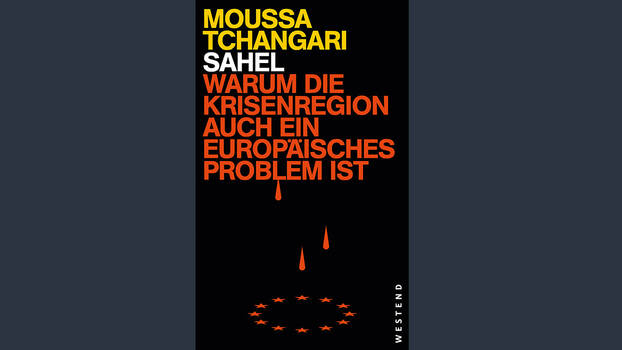
Im November 2023 veröffentliche RLS-Partner Moussa Tchangari sein Buch «Sahel. Warum die Krisenregion auch ein europäisches Problem ist». Wir veröffentlichen einen Auszug daraus mit Bezug zum Putsch in Niger im Juli 2023, seinen Beziehungen zum Westen, den zunehmenden autoritären Tendenzen und der Rolle von Öl.
Moussa Tchangari ist Generalsekretär der RLS-Partnerorganisation Alternative Espaces Citoyens, einer der wichtigsten zivilgesellschaftlichen Organisationen im Niger. 1991 war er einer der Gründer der Menschenrechtsvereinigung L’Association Nigérienne de Défense des Droits de l’Homme (ANDDH).
In den letzten Wochen ist deutlich geworden, dass sich die Militärputschisten und ihre zivilen Unterstützer sehr wohl darüber im Klaren sind, was die aktuelle Krise für die ausländischen Mächte bedeutet. Auch ist ihnen nicht entgangen, dass der aktuelle internationale Kontext, der von starken Rivalitäten zwischen diesen Mächten geprägt ist, gewisse Spielräume eröffnet, die sie nutzen können, um sich an der Macht zu halten. So ist festzustellen, dass das nigrische Militär bei der Durchführung seines Staatsstreichs zwei Faktoren nicht aus den Augen verloren hat, die es zu seinem Vorteil nutzen kann: erstens die Schwierigkeit, dass sich die ausländischen Mächte, obwohl sie die gewaltsame Machtübernahme einhellig verurteilen, nicht auf ein Vorgehen einigen konnten, um die Putschisten zur Rückkehr in ihre Kasernen zu zwingen. Zweitens die reale Möglichkeit einer Unterstützung autoritärer Restaurationsprojekte durch Mächte wie Russland und China, die solche Unternehmungen nicht als Bedrohung ihrer strategischen Interessen ansehen.
Neben diesen beiden Faktoren darf zudem nicht vergessen werden, dass die Militärputschisten und ihre zivilen Unterstützer nicht die in der Sahelzone tief verwurzelten Ressentiments gegenüber den vor Ort präsenten westlichen Mächten aus den Augen verloren haben. Dabei haben sie aus den Erfahrungen in Mali und Burkina Faso gelernt, dass diese Ressentiments, die mit einer starken Forderung nach Souveränität einhergehen, als Hebel dienen können, um das eigene Auftreten auf der politischen Bühne vor Ort zu legitimieren und jede Macht, die sich ihnen entgegenstellt, in die Defensive zu drängen. Die Aufkündigung der mit Frankreich geschlossenen Verteidigungsabkommen und die Entlassung des französischen Botschafters in Niamey sind eindeutig Teil dieser Strategie, die bereits von der malischen und der burkinischen Junta erprobt worden ist. Die politischen und diplomatischen Gewinne der nigrischen Junta sind beträchtlich und äußern sich in einer Deutung der Krise als einer solchen, die maßgeblich um die nationale Souveränität kreist.
In Niamey wie auch im Inneren des Landes gelang es der Militärjunta, die Präsenz ausländischer, insbesondere französischer Streitkräfte in den Mittelpunkt der aktuellen Krise zu rücken; und das, obwohl General Tiani diese Präsenz in seiner ersten offiziellen Erklärung selbst zu rechtfertigen schien, indem er von einer «willkommenen und geschätzten Unterstützung» im Kampf gegen die bewaffneten Gruppen sprach. Die Radikalisierung der Junta in dieser Frage ist in erster Linie als Reaktion auf die harte Haltung Frankreichs zu verstehen, das sich offen für die Unterstützung einer möglichen militärischen Intervention der ECOWAS (Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft, Anm. RLS) einsetzt. Die Junta hat hierbei ein doppeltes Interesse: Es geht nicht nur darum, die nationale und regionale Öffentlichkeit gegen eine Initiative zu mobilisieren, die berechtigte Ängste hervorruft, sondern es sollen auch die eigentlichen Motive des Staatsstreichs verschleiert werden, indem dieser feierlich in das noble Register der Kämpfe um die nationale Souveränität eingetragen wird – ein Thema, das in der Sahelzone derzeit sehr mobilisierend wirkt.
Der Geruch von Rohöl
Heute (deuten …) mehrere Quellen darauf hin, dass der Staatsstreich vom 26. Juli vor allem das Ergebnis regimeinterner Meinungsverschiedenheiten über die Verwaltung des Erdöl-Mannas war (…). (Die Junta) scheint sich (…) des Umstandes bewusst zu sein, dass viele ihrer eigenen zivilen und militärischen Unterstützer auf klare Signale warten, dass sie nicht etwa den bewaffneten Arm des ehemaligen Präsidenten (Mahamadou Issoufou, Anm. RLS) darstellt. Die Demonstrationen der letzten Wochen, deren Hauptthema der sofortige Abzug der französischen Streitkräfte aus Niger war, wurden von einigen zum Anlass genommen, die Junta daran zu erinnern, dass ihre Unterstützung nur dann endgültig gesichert ist, wenn sie sich vom ehemaligen Präsidenten distanziert, welcher beschuldigt wird, der eigentliche Anstifter zum Putsch vom 26. Juli gewesen zu sein.
Tatsächlich ist es von großer Bedeutung, sich bewusst zu machen, dass viele Unterstützer der Militärjunta die Berichte über die problematische Rolle des ehemaligen Präsidenten bei diesen Ereignissen sehr ernst nehmen. Dies hat seinen Grund zum einen darin, dass seine Nähe zum Hauptverantwortlichen des Putsches, General Tiani, der während seiner zehnjährigen Herrschaft für die Sicherheit des Präsidenten zuständig war, allgemein bekannt ist. Zum anderen war die Bevölkerung schon länger davon überzeugt, dass Issoufou durch die Ernennung seines Sohnes zum Leiter des Erdölministeriums weiterhin die Kontrolle über die Verwaltung dieser Ressource behalten wollte. Der nigrische Journalist Sidik Abba, einer derjenigen, die versucht haben, die wahren Motive des Staatsstreichs vom 26. Juli aufzudecken, berichtet, dass alles seinen Anfang mit einem am Vortag abgehaltenen Treffen zwischen Präsident Bazoum und seinem jungen Ölminister genommen habe. Ziel des Treffens sei es gewesen, den Präsidenten dazu zu bringen, einen Freund des Ministers zum Leiter der neuen Gesellschaft zu ernennen, die mit der Verwaltung des Rohöls betraut werden sollte. Dies soll er kategorisch abgelehnt haben, was den Zorn des Issoufou-Clans hervorrief, der daraufhin die Putschmaschine in Gang setzte.
Während der zweijährigen Amtszeit von Präsident Bazoum haben zahlreiche Beobachter der nigrischen politischen Szene die Vermutung angestellt, dass der Einfluss des ehemaligen Präsidenten Issoufou den Willen seines Nachfolgers, die Regierungsführung des Landes zu verbessern, negativ beeinflusst haben könnte. (…) Die Wahrheit ist, dass Präsident Bazoum, der sich im Zeichen der Kontinuität wählen ließ – sein Wahlkampfslogan lautete «Konsolidieren und vorankommen» – es versäumt hat, seinen Willen, mit der Politik seines Vorgängers zu brechen, deutlich zum Ausdruck zu bringen.
Zwar war sein Wille, anders als sein Vorgänger den Dialog gegenüber der Konfrontation mit den politischen und sozialen Akteuren zu bevorzugen, allgemein bekannt, doch gelang es ihm nicht, diesen Willen in konkrete Handlungen umsetzen; angesichts der enormen Herausforderungen, vor denen das Land stand, wären Initiativen vonnöten gewesen, um einen breiten Konsens unter den Eliten zu erreichen. Die politische und wirtschaftliche Bedeutung, die einem breiten Elitenkonsens für ein Land wie Niger zukommt, wurde von dem britischen Ökonomen Stefan Dercon, im Anschluss an eine Vielzahl nationaler Akteure, auf einer von ihm angeregten Konferenz im November 2022 in Niamey herausgestellt. Der Autor von Gambling on Development stellt hierzu fest, dass es sich bei den Ländern, die ihre Volkswirtschaften und den Lebensstandard ihrer Bevölkerung erfolgreich verbessern konnten, um diejenigen handelt, in denen die Eliten formelle oder informelle Vereinbarungen miteinander getroffen haben, die konsequent auf ein integratives Wachstum und eine entsprechende Entwicklung ausgerichtet sind.
Das Problem Nigers – eines jener Länder, deren Wirtschaft stagniert und in denen die Zahl der Armen noch immer steigt – besteht Stefan Dercon zufolge darin, dass es seinen Eliten nicht gelungen ist, solche Vereinbarungen miteinander auszuhandeln. Bedauerlicherweise ist die Aussicht, dass die Eliten dieses Problem angehen werden, um die relative Stabilität des Landes und die mit der Erdölförderung verbundenen Chancen besser nutzen zu können, mit dem Putsch vom 26. Juli in weite Ferne gerückt. Die Rückkehr des Militärs auf die politische Bühne, gepaart mit der offensichtlichen Komplizenschaft derjenigen, die die Jahre der Stabilität genutzt haben, um den Staat Niger in einen Klientelstaat zu verwandeln, wird die Chancen des Landes, von einer bislang günstigen historischen Konjunktur zu profitieren, weiter verringern. Denn auch wenn das Land noch immer auf erhebliche Einnahmen aus dem Export von Rohöl hoffen kann, bleibt angesichts des Appetits, den diese bereits wecken, die Herausforderung bestehen, eine transparente und auf die Verringerung von Ungleichheiten ausgerichtete Verwaltung dieser Einnahmen sicherzustellen.
Hierbei dürfen wir uns nichts vormachen: Das Risiko, dass die künftigen Einnahmen aus dem Rohölexport in erster Linie dazu dienen werden, den Stand einer neuen autoritären Macht zu festigen, wie man sie in vielen Ländern Afrikas und anderswo antreffen kann, ist beträchtlich. Wo dies bereits der Fall ist, haben die Einnahmen aus dem Rohstoffabbau autoritäre Tendenzen genährt und klientilistische Systeme gestärkt, die die Mehrheit der Bevölkerung ausschließen. Die putschenden Militärs in Niger haben sicherlich nicht aus den Augen verloren, welche Möglichkeiten die Aussicht, bereits im nächsten Jahr über diese Einnahmen verfügen zu können, für sie eröffnet. Mit diesen Einnahmen wird es ihnen nicht nur möglich sein, äußerem Druck besser standzuhalten, sondern sich auch die Loyalität einiger nationaler Akteure durch Korruption zu sichern. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Ölgeld dazu verwendet wird, auf Entwicklung zu setzen, wie dies der britische Ökonom empfiehlt, bleibt also sehr gering. Vor allem angesichts der stetigen Verschlechterung der Sicherheitslage, die in der gesamten Region zu beobachten ist.
Auf dem Weg zu einer autoritären Restauration
Durch den Militärputsch in Niger ist deutlich geworden, dass eine beträchtliche Zahl von Bürgern dieses Landes nicht weit davon entfernt ist zu glauben, dass ein Militärregime besser als ein ziviles Regime dazu in der Lage ist, die gegebenen Herausforderungen zu bewältigen. Diese Überzeugung versuchen einige intellektuelle Unterstützer der Militärjunta durch Analysen zu verdeutlichen, laut denen die Einführung der Demokratie einen ernsthaften Beitrag zur Destabilisierung der Staaten in der Sahelzone geleistet habe. Die Unterstützung für den Militärputsch speist sich nicht nur aus dem Groll, der sich während der zwölfjährigen Regierung der PNDS-Tarayya angesammelt hat, oder aus der Wut über die Sanktionen und Drohungen der ECOWAS. Sie speist sich auch aus einer Generalabrechnung mit dem Modell der repräsentativen Demokratie selbst, das als importiertes Produkt, wenn nicht gar als trojanisches Pferd des Westens dargestellt wird, das nur dazu diene, die Sahelzone zu spalten, um sie besser beherrschen zu können.
Man kann also sagen, dass nach Mali und Burkina Faso nun auch Niger auf dem besten Weg ist, die bittere Erfahrung einer Militärmacht zu wiederholen, wobei sich diese Erfahrung als weitaus furchtbarer erweisen könnte als jene, die das Land in der jüngeren Vergangenheit gemacht hat. Dennoch ist die Hoffnung, dass die nationalen und regionalen Akteure eine Anstrengung unternehmen werden, um die durch den Staatsstreich vom 26. Juli ausgelöste Krise in eine Chance zu verwandeln und die Demokratie wieder auf Kurs zu bringen, noch nicht ganz erloschen. Diese Krise hat, wie man sich erinnern sollte, die Spaltungen und Abspaltungen offenbar gemacht, die die nigrische Gesellschaft durchziehen. Gleichzeitig hat sie vielen Nigrern das Interesse der internationalen Großmächte an ihrem Land bewusst gemacht. Die verschiedenen Reaktionen auf den Militärputsch sowohl innerhalb als auch außerhalb des Landes sind sehr lehrreich, denn sie zeigen, dass viele Akteure sich gar nicht erst die Mühe machen, den Militärputsch in den Rahmen der globalen Krise einzuordnen, die die Sahelzone seit einem Jahrzehnt durchlebt.
Es ist jedoch wichtig, sich vor Augen zu halten, dass die Rückkehr des Militärs an die Macht in Niger, ebenso übrigens wie in Mali und Burkina Faso, nicht allein als Symptom einer Krise der Demokratie zu betrachten ist; vielmehr ist sie auch der Preis für das Scheitern aller bisherigen Bemühungen, die bewaffneten Gruppen zu bezwingen – angefangen beim Einsatz ausländischer Kräfte vor Ort, der nicht dazu geführt hat, die Unsicherheit in den Ländern zu verringern. Die Rhetorik der Militärputschisten in Niger, wie auch in Mali und Burkina Faso, ist in dieser Hinsicht eindeutig: Sie weisen die Schuld an diesem Misserfolg den zivilen Führern zu, denen sie vorwerfen, schlechte Entscheidungen getroffen zu haben, wie auch den ausländischen Kräften, die als Komplizen der bewaffneten Gruppen dargestellt werden. Für die Militärputschisten geht es nicht nur darum, den Anteil der Verteidigungs- und Sicherheitskräfte an diesem Misserfolg zu verschleiern, sondern sich vor allem als Befreier der Völker aufzuspielen, denen die zivilen Führer und ihre ausländischen Verbündeten nicht die Sicherheit bieten konnten, welche sie zu Recht erwartet hatten.
In Bamako und Ouagadougou haben sich Oberst Goïta und Hauptmann Traoré in diesem Spiel ihre Sporen als «Befreier der Völker» verdient, nicht indem sie entscheidende Schlachten gegen bewaffnete Gruppen gewannen, sondern indem sie die französischen Streitkräfte aus ihren Ländern vertrieben. In Niamey hofft nun General Tiani, der in die Fußstapfen seiner Kollegen aus Mali und Burkina Faso tritt, sich seinerseits die Sporen zu verdienen, durch sein Kräftemessen mit der ECOWAS, die ihm seine Macht zu entreißen droht, und mit Paris, das sich weigert, seine Streitkräfte aus Niger abzuziehen (die nun bis Ende 2023 abgezogen werden, Anm. RLS). Die Prätorianer der Sahelzone mussten keine kriegerischen Heldentaten vollbringen, um als Helden gefeiert zu werden; das einzige, was sie hierfür zu tun brauchten, war, die Kritik an der Präsenz der französischen Streitkräfte aufzugreifen, denen eine Komplizenschaft mit den bewaffneten Gruppen vorgeworfen wird. Die kritischen Stimmen sind selbst da, wo sie sich zaghaft zu äußern wagen, kaum hörbar, denn sie gehen im Konzert der patriotischen Propaganda unter, die von den Militärs und ihren zivilen Unterstützern orchestriert wird.
Angesichts dieses Klimas kann man ermessen, wie groß die Gefahr ist, dass die Länder der Sahelzone langfristig und dauerhaft in den Autoritarismus früherer Zeiten zurückfallen. In Mali und Burkina Faso ist die Lage bereits besorgniserregend. Dort sorgen neben dem staatlichen Repressionsapparat auch aufgeheizte Partisanentrupps dafür, dass jede abweichende Stimme zum Schweigen gebracht wird. Die Agenda der Militärregime besteht darin, den aktuellen Konflikt zu nutzen, um sich an der Macht zu halten, und aus diesem Grund scheinen sie keine andere als eine militärische Lösung für den Konflikt in Betracht zu ziehen. Die Pflicht all derer, die sich um die Zukunft der Sahelzone sorgen, besteht daher nicht nur darin, sich der gewaltsamen Machtübernahme und den bereits zu beobachtenden autoritären Tendenzen zu widersetzen, sondern auch den Anspruch des Militärs, für eine «totale Sicherheit» (als Versprechen einer «Law-and-Order»-Politik; Anm. d. Übers.) zu sorgen, entschieden abzulehnen, da diese gemeinsam mit den Zivilmächten gescheitert ist.
Heute muss sich die Erkenntnis durchsetzen, dass die aktuelle politisch-sicherheitspolitische Krise in der Sahelzone, die den Weg für das Vordringen der Armeen auf die politische Bühne geebnet hat, in erster Linie eine Legitimitätskrise des postkolonialen Staates ist. Diese Krise, die sich darin äußert, dass die Staaten Schwierigkeiten haben, Sicherheit und Wohlstand für die in ihren Gebieten lebende Bevölkerung zu gewährleisten, hat einige Bürger dazu veranlasst, sich zusammenzuschließen, um selbst für ihre Sicherheit zu sorgen. Das kann man in Ländern wie Mali und Burkina Faso sehen, wo solche Initiativen zu tödlichen Konflikten zwischen Gemeinschaften geführt haben.
Die aktuelle Situation in der Sahelzone lässt auf eine doppelte Dringlichkeit schließen: Erstens muss ein neuer sozialer und politischer Vertrag geschlossen werden, um den Staaten (wieder) die Kraft und die Mittel zu verschaffen, die ihnen fehlen, um ihren Verpflichtungen nachzukommen und an Legitimität zu gewinnen; zweitens muss unermüdliche Bildungsarbeit geleistet werden, um Bürgerinnen und Bürger auszubilden, die den demokratischen Werten stärker verbunden sind, und um die Politik zu verändern, damit sie ihre ursprüngliche Berufung wiederfindet: auf den Frieden hinzuarbeiten.
Das Buch «Sahel. Warum die Krisenregion auch ein europäisches Problem ist» ist im Westend Verlag erschienen und kann dort bestellt werden: https://www.westendverlag.de/buch/sahel/.