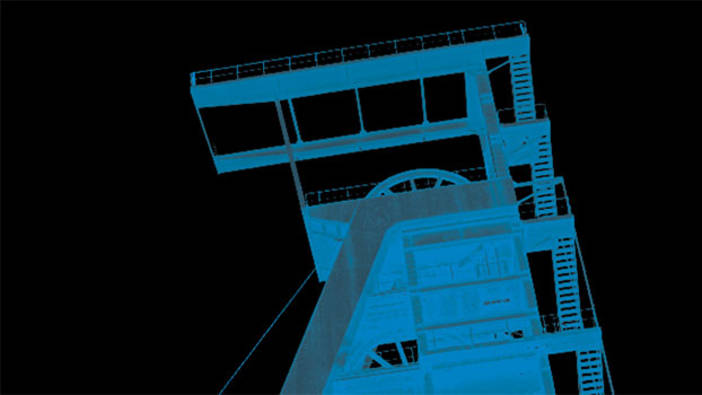Für die Rosa-Luxemburg-Stiftung waren 30 Jahre deutsche Einheit und die Transformationserfahrungen der Ostdeutschen ein Schwerpunkt der politischen Bildungsarbeit im vergangenen Jahr. Wir sprachen mit Dagmar Enkelmann, Vorstandsvorsitzende der Stiftung, über gesellschaftliche Herausforderungen des Einigungsprozesses und über ihre persönliche Bilanz.
Rosa-Luxemburg-Stiftung: Jährlich legt der Ostbeauftragte der Bundesregierung den Jahresbericht zum Stand der Deutschen Einheit vor. Für die Bundesregierung ist die deutsche Einheit eine Erfolgsgeschichte. Wie ist deine Einschätzung?
Dagmar Enkelmann: Der Bericht soll Erfolge, Probleme und Tendenzen aufzeigen. Die Zahlen zeigen: eine Erfolgsgeschichte sieht anders aus. Dokumentiert wird ein stabiles West-Ost-Gefälle. Beispielsweise habe die Wirtschaftskraft der neuen Länder 2019 bei 79,1 Prozent des gesamtdeutschen Durchschnitts gelegen und das verfügbare Haushaltseinkommen in Ostdeutschland jetzt 88,3 Prozent erreicht. Nach wie vor verdienen Beschäftigte in den neuen Bundesländern bei gleicher Qualifikation deutlich weniger als Arbeitnehmer*innen im Westen. Der Lohnabstand beträgt laut einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung bei Beschäftigten gleichen Geschlechts, im gleichen Beruf und mit vergleichbarer Berufserfahrung knapp 17 Prozent. Aber, es geht nicht nur um Ungleichheiten bei Themen wie Infrastruktur und aktuelle Lebenschancen, sondern auch um unterschiedliche Wertorientierungen, Lebenshaltungen und Lebensentwürfe. Ich vermisse eine ehrliche Aufarbeitung der Fehler der Einheit und Konzepte für die weitere Entwicklung.
Der Ostbeauftragte beklagt «große Demokratiedefizite» bei Ostdeutschen und begründet dies mit «Diktatur-sozialisiert»…
Seit 30 Jahren höre ich, dass die DDR an den Problemen im Osten Schuld sei. Vielleicht ist es an der Zeit, dass die Bundesregierung mal über eigene Fehler nachdenkt. Ich möchte an die ersten Erfahrungen und Enttäuschungen der Ostdeutschen Anfang der 90er Jahre mit der westdeutschen Demokratie erinnern: die Entwertung ostdeutscher Biografien, die Massenarbeitslosigkeit, die Übernahme der politischen und wirtschaftlichen Führungsämter durch westdeutsche Eliten. Im Mai vergangenen Jahres schrieb Wolfgang Engler für unsere Stiftung einen Text zum Thema «Die Ostdeutschen und die Demokratie». Ich zitiere: «Die notorische Ausblendung der Nachwendegeschichte bei der Ergründung der Ursachen für die ‹Rechtslastigkeit› der Ostdeutschen ist interessengeleitet, ist ordinäre Ideologie.» Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen.
30 Jahre deutsche Einheit und Transformationserfahrungen – ein Thema nur in Ostdeutschland?
Am Anfang hatten wir das befürchtet. Aber, das ist nicht so. Mit unserer Wanderausstellung zum Thema «Schicksal Treuhand – Treuhand-Schicksale» machen wir Lebensläufe sichtbar und geben Raum für das Erzählen der eigenen Geschichte. Damit haben wir den Nerv vieler Ostdeutschen getroffen. Eröffnet wurde die Ausstellung im August 2019 in Erfurt. Seitdem tourt sie deutschlandweit. Das Interesse in den ostdeutschen Ländern ist beträchtlich. Zu den 19 Orten, an denen die Ausstellung bisher zu sehen war, gehören aber auch Heidelberg, Braunschweig, Fürstenfeldbruck und Erlangen. Viele Besucher nutzen unser Gästebuch für persönliche Kommentare, darunter: «Zwei Wessis waren überrascht – das wussten wir so nicht. TRAURIG, sehr informativ.» Das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Offenbar ist dieser Teil der Geschichte in der gesellschaftlichen Debatte bislang zu kurz gekommenen.
Was macht denn die Brisanz bei der Geschichte der Treuhandanstalt aus?
Die Folgen der Privatisierungspolitik der Treuhandanstalt haben ganze Generationen von DDR-Bürger*innen getroffen. Unverschuldet verloren sie ihren Arbeitsplatz und damit ihre komplette Existenzgrundlage. Zugleich wurden ihre bisherigen Lebensläufe diskreditiert. Lange wurde über diese Zeit und die damit verbundenen Brüche in der Biografie geschwiegen. Das Gefühl, Bürger*innen zweiter Klasse zu sein, hielt viele davon ab, zu reden. Deshalb ist eines der Hauptanliegen der Rosa-Luxemburg-Stiftung, Räume zu schaffen für offene Diskussionen. Für jüngere und künftige Generationen ist es wichtig, dass Betroffene ihre Treuhandgeschichte aus ostdeutscher Perspektive erzählen. Wir wollen den individuellen Blick zurück der Eltern- und Großelterngeneration verbinden mit einer Debatte über die politische Aufarbeitung der Treuhandpolitik. Die Folgen sehen wir in Ostdeutschland noch heute: ein kleinteiliges Wirtschaftssystem, fehlende Technologiebasis für nachhaltige Entwicklung, Altersarmut … Es stellt sich die dringliche Aufgabe, den Weg der Deutschen Einheit neu zu reflektieren und den Blick nach vorn zu richten. Das Versprechen der gleichberechtigten sozialen und demokratischen Teilhabe ist auch 30 Jahre nach dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik noch nicht erfüllt. Wir müssen über gesellschaftliche Alternativen nachdenken.
Welche Projekte gab es darüber hinaus?
In einer Online-Chronik erzählen wir «eine andere Geschichte» der Wendezeit: Es geht um die Zeit 1989/90 in der alles möglich zu sein schien, um die Aufbruchsstimmung und den Zukunftsoptimismus, die Hoffnungen und Wünsche, aber auch die Niederlagen. Ausgangspunkt waren die Kommunalwahlen am 7. Mai 1989 als Initialzündung und die Implosion der DDR. Es war auch für mich überraschend, dieses eine Jahr noch einmal anhand der markanten Ereignisse nachzuvollziehen. Wir haben zahlreiche Diskussionsbeiträge auf unserer Internetseite veröffentlicht – nachlesen kann man sie in einem Online-Dossier. In Publikationen haben wir Erfahrungen und Ereignisse dieser Zeit neu sichtbar gemacht: beispielsweise über das turbulente erste Jahr der PDS, über die Initiative für eine Vereinigte Linke, über Repressionen gegen Linke und emanzipatorische Bewegungen in der DDR, aber auch die Unterstützung der Herausgabe der dreibändigen Kulturgeschichte der DDR von Gerd Dietrich und der Veröffentlichung der Tonbandprotokolle des Parteiausschlusses des Politbüros vom Dietz-Verlag haben wir wichtige Erfahrungen und Ereignisse dieser Zeit aus dem Vergessen geholt.
Vergessen ist ein gutes Stichwort. Wie war dein Weg in die deutsche Einheit?
Ich habe 1989 mein drittes Kind bekommen und war im Babyjahr. Ich habe die politische Entwicklung verfolgt, saß erst für die PDS am Runden Tisch in Bernau und wurde kurze Zeit später in die Volkskammer gewählt. Ich erinnere mich noch gut an den 5. April 1990, den Tag der konstituierenden Sitzung der Volkskammer im Palast der Republik. Auf dem Parkplatz davor standen viele Autos, deren Marken ich damals noch nicht kannte. Mittendrin mein himmelblauer Trabant. Ich gehörte das erste Mal der Volkskammer an, alles war neu für mich und viele Fraktionskollege*innen. Die anderen Fraktionen hatten da schon ihre «westdeutschen Entwicklungshelfer». Trotzdem, es gab ein anderes Miteinander als später im Bundestag. Alle waren DDR-sozialisiert, trotz der unterschiedlichen Biografien gab es ein kollegiales Verhältnis. Später in Bonn hatten wir anfangs eine informelle «Ostrunde», um mit Kolleg*innen aus den neuen Ländern die speziellen Aufgaben und Probleme nach der Einheit zu besprechen. Die CDU-Spitze bekam das mit und hat es für ihre Abgeordneten sofort unterbunden.
Deine Volkskammerzeit war nur kurz. Am 23. August 1990 hatte die Volkskammer mehrheitlich den Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland nach Artikel 23 des Grundgesetzes beschlossen …
Die PDS-Fraktion hatte geschlossen dagegen gestimmt. Für uns waren wichtige Wirtschafts- und Sozialfragen nicht gelöst. Es war absehbar, dass die Einheit nicht auf Augenhöhe vollzogen wird. Am 2. Oktober gab es dann eine Sondersitzung im DDR-Staatsratsgebäude und die Einheitsfeier im Konzertsaal am Gendarmenmarkt. An letzterer habe ich nicht teilgenommen, ich bin in mein Wahlkreisbüro nach Bernau gefahren. Dort haben wir uns mit Gleichgesinnten getroffen, zusammengesessen und gesprochen. Ich erinnere mich, dass André Stahl, der heutige Bernauer Bürgermeister dabei war. Wir waren uns einig, Sozialist*innen muss es auch im neuen Deutschland geben. Um Mitternacht erklangen dann die Nationalhymne der DDR und das Deutschlandlied.
Wir waren die ersten Tage in Bonn?
Am 3. Oktober gab es eine Sondersitzung im Bundestag und danach begann die normale Sitzungswoche. Es war ein komisches Gefühl. Das Plenum tagte im Wasserwerk, Büros hatten wir im ehemaligen Kindergarten am Tulpenfeld zugewiesen bekommen. Die Abgeordneten der anderen Parteien aus der Volksammer wurden von den Fraktionen aufgenommen, wir waren von Anfang an separat. Mir ist als erstes aufgefallen, dass es keine Zähler*innen wie in der Volkskammer gab. Kurze Zeit danach war mir klar, warum. Die Abstimmungsblöcke standen. Am Donnerstag beispielsweise war immer «Abstimmung ohne Debatte». Die Drucksachen wurden aufgerufen, ohne Titel oder Thema, um das es ging. Wir waren ein Tag vorher angekommen und hatten keinen Schimmer. Erst haben wir uns enthalten, dann war es uns zu blöd und wir sind das erste Mal als Gruppe aus dem Bundestag ausgezogen. Irgendwann später haben wir durchgesetzt, dass wenigsten der Titel der Vorlagen genannt wird. Auch an die Ausschussarbeit und anderen Termine während der Plenarsitzungen mussten wir uns erst gewöhnen. Schnell lichteten sich die Reihen im Plenum, nur die ostdeutschen Abgeordneten blieben am Anfang sitzen …
Am 2. Dezember 1990 fand die erste gesamtdeutsche Bundestagswahl statt. Durch ein Sonderwahlgesetz gab es die getrennten Wahlgebiete Ost und West. Wenn eine Partei in einem Wahlgebiet fünf Prozent überschritten hatte, zog sie in den Bundestag ein. So auch die PDS/Linke Liste …
Wir konnten 17 Mandate erringen. Damit hatten wir, ehrlich gesagt, nicht gerechnet. Für uns und unsere Mitarbeiter*innen war der Parlamentsbetrieb in Bonn eine große Umstellung. Für die etablierten Parteien waren wir eine Zumutung. Wir hatten nicht nur unkonventionelle Politikansätze, sondern auch eine gute Kinderstube. Die Mitarbeiter*innen der Bundestagsverwaltung freuten sich über «Danke» und «Bitte» und haben uns von Anfang an geholfen. Und wir waren nicht nur im übertragenen, sondern auch im wörtlichen Sinn eine «bunte Truppe». Die PDS brachte Farbe ins Parlament, vor allem wir jungen Frauen trugen mit Vorliebe rot.
Das ist sogar den Journalisten aufgefallen, die Dich zur «Miss Bundestag» wählten …
Ich war darüber anfangs gar nicht glücklich, fühlte mich auf das Äußere reduziert und als Politikerin nicht ernst genommen. Gregor (Gysi – d. Red.) erkannte sofort die Chance, über diesen Weg mehr Öffentlichkeit für die politische Arbeit zu erlangen. Ich wurde in Talkshows eingeladen, es gab zahlreiche Interviewanfragen, und konnte über diesen Weg Aufmerksamkeit auch für unsere politischen Inhalte erreichen. Und noch Jahre später wurde ich immer wieder in Interviews darauf angesprochen.
«Deutschland – einig Vaterland?» - am 17. September 2020 hat die Rosa-Luxemburg-Stiftung gemeinsam mit der Linksfraktion im Bundestag eine Podiumsdiskussion zu dem Thema durchgeführt. Wie bewertest Du heute den Stand der deutschen Einheit?
Die Einheit ist nach wie vor unvollendet. Für die DDR-Bürger*innen brachte sie neue Möglichkeiten und Freiheiten. Aber nicht Jede*r konnte diese nutzen. Es gibt nach wie vor viele Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten – wirtschaftlich, kulturell, sozial. Wenn sich nach einer Forsa-Umfrage des Bundespresseamtes nach drei Jahrzehnten deutscher Einheit noch 57 Prozent der Ostdeutschen als Bürger*innen zweiter Klasse fühlen, dann ist gewaltig was schiefgelaufen.