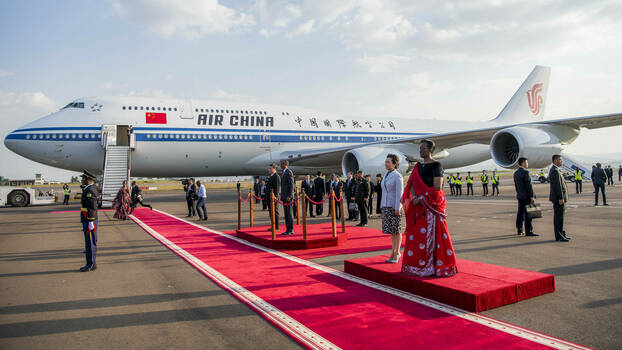
Chinas Einfluss in Ländern des afrikanischen Kontinents entstand durch jahrzehntelange Förderung von gemeinsamen, aus den Tagen des Antikolonialismus und des Kalten Krieges stammenden Interessen. Dabei wurden viele Fehler begangen und manche Lektion gelernt. Die jüngsten Entwicklungen zeigen, dass es nötig ist, die politische Einstellung zueinander zu überprüfen, insbesondere, um neben Regierungen und deren Parteien auch andere Akteure ins Boot zu holen. Aber diese Aufgabe obliegt, anders als viele Beobachter meinen, nicht allein China. Die Länder Afrikas müssen sich stärker engagieren, den Idealen einer Partnerschaft auf Augenhöhe gerecht werden, und China muss ein gewisses Maß an Verantwortung zeigen: nicht nur gegenüber afrikanischen Regierungen und Politikern, sondern vor allem gegenüber den Menschen in Afrika.
Muhidin Shangwe hat Politikwissenschaft, Öffentliche Verwaltung und Internationale Beziehungen studiert. Er ist Dozent an der Universität von Daressalam, Tansania. Derzeit befasst er sich mit chinesischer Soft Power in Afrika.
Als erstes afrikanisches Land nahm Ägypten 1956 offizielle diplomatische Beziehungen zur Volksrepublik China auf. Gefestigt haben sich die diplomatischen Beziehungen zwischen Afrika und China erst in den 1970er Jahren. Nach Zhou Enlais Besuchen in zehn afrikanischen Staaten kannte 1965 jedes Kind den chinesischen Premierminister. Während dieses und des darauffolgenden Jahrzehnts intensivierte China die Beziehungen auch in anderer Hinsicht und leistete für Afrika wichtige Wirtschafts- und Militärhilfe. So stammten 1972 beispielsweise 75 Prozent der Militärhilfe für die Organisation für Afrikanische Einheit (OAU) aus China. Hinzu kam, dass Peking etwa zur gleichen Zeit eine 1.860 Kilometer lange Eisenbahnstrecke baute, die den Binnenstaat Sambia mit dem Küstenstaat Tansania verband. Im Gegenzug unterstützte Afrika China auf der weltpolitischen Bühne. Erstens, indem es 1971 eine Schlüsselrolle bei der Wiederherstellung des chinesischen Sitzes bei den Vereinten Nationen spielte: 26 von 76 Stimmen kamen aus afrikanischen Ländern. Zweitens, indem politische Loyalitäten von Taiwan auf Peking umschwenkten. Hatten 1963 noch 19 afrikanische Länder Taiwan anerkannt und nur 13 China, drehte sich der Spieß bis 1975 um. Dies verdeutlicht den Hintergrund einer Beziehung, die auf gegenseitigen, aus einer Zeit des antikolonialen Kampfes und des Kalten Krieges stammenden Interessen basiert. Die Notwendigkeit, jenseits der Ost-West-Rivalität einen dritten Weg zu finden, führte zu einer «Trikont-Haltung», die sich häufig in afroasiatischer Solidarität ausdrückte.
Sowohl in Afrika als auch in China haben sich seit Ende der 1980er Jahre bedeutende Veränderungen vollzogen. Seit Deng Xiaoping das Amt des Staatspräsidenten übernahm, hat China umfassende Wirtschaftsreformen eingeleitet. Bei diesem «Sozialismus mit chinesischen Merkmalen» handelt es sich um eine mit dem westlichen Turbo-Kapitalismus vergleichbare Marktwirtschaft und um ein hochgradig zentralisiertes politisches System unter der Kommunistischen Partei Chinas. Ein solch rasanter wirtschaftlicher Wandel kann für die Länder Afrikas nicht behauptet werden – trotz des stetigen Wirtschaftswachstums in einigen von ihnen. China ist heute die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und die Nummer eins unter den Exporteuren. Nicht nur die Nachfrage nach Rohstoffen ist exponenziell gestiegen, offensichtlich wurde auch die Notwendigkeit eines externen Markts für chinesische Waren. Anfang der 1990er Jahre leitete Peking nach der Devise «Traut euch raus!» eine Politik ein, die chinesische Staats- und Privatunternehmen zu Auslandsaktivitäten ermutigte. Afrika bot sich dafür dank seines natürlichen Ressourcen-Reichtums an. Seither ist China hier zum größten Einzelzahler ausländischer Direktinvestitionen (FDI) geworden und verdrängte 2009 auch als Handelspartner die USA von Platz eins. Der Rest ist, wie es so schön heißt, Geschichte.
Reformen gab es währenddessen auch in den afrikanischen Ländern: Seit den 1990er Jahren haben sie versucht, sich an politische Empfehlungen von einzelnen westlichen Ländern und multilateralen Organisationen, wie der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds, anzupassen. Die Ergebnisse waren bestenfalls enttäuschend, denn für ein besseres Leben der Afrikaner reichte das Wachstum nicht. Ein weiterhin auf Industrialisierung angewiesener Kontinent und ein Land, das sowohl Rohstoffe für seinen Produktionssektor benötigt als auch neue Absatzmärkte, entwickelten also Wirtschaftsbeziehungen. Ohne politische und ideologische Aspekte herunterzuspielen, lassen sich die heutigen Beziehungen zwischen Afrika und China deshalb vorrangig als Geschäftsbeziehungen beschreiben, die an ihrem ökonomischen Nutzen gemessen werden.
Für den afrikanischen Kontinent ist China aus unterschiedlichen Gründen wichtig, von denen ich vier nenne: Erstens liefern die Chinesen greifbare Ergebnisse in Form von Straßen, Eisenbahnen, Häfen und Flughäfen. An derartiger Infrastruktur-Entwicklung haben westliche Kreditgeber seit dem Kalten Krieg wenig Interesse gezeigt. Zweitens verfolgt Peking im Umgang mit afrikanischen Ländern eine Politik der Nichteinmischung, was die Beziehungen wie eine gleichberechtigte Partnerschaft erscheinen lässt.
Drittens hat China keine Kolonialgeschichte auf dem afrikanischen Kontinent. Anders als etwa Christoph Kolumbus gilt Zheng He, der legendäre chinesische Admiral, dessen Expeditionen ihn im 15. Jahrhundert an die Küste Ostafrikas führten, nicht als Kolonialherr. Seine gut gemeinten Expeditionen symbolisieren im gegenwärtigen Beziehungsgeflecht beider Länder Chinas gute Absichten.
Viertens lässt sich Chinas wirtschaftlicher Wandel in Echtzeit mitverfolgen, und deshalb glauben viele Afrikaner*innen, dass auch bei ihnen eine solche Entwicklung möglich ist.
All diese Faktoren begründen eine Soft Power, die genau genommen den größten Unterschied beispielsweise zu Europa ausmacht: Während die Chinesen für den Bau einer Straße in einem afrikanischen Land einen Kredit zu Sonderkonditionen gewähren und einen Bauunternehmer stellen, würden die Europäer von diesem Land verlangen, dass es zuerst an der Korruptionsbekämpfung arbeitet, um überhaupt kreditwürdig zu sein. Den Europäern sind Menschenrechte genauso wichtig wie Straßen, wenn nicht sogar wichtiger – was vom Empfängerland in der Regel als Einmischung in innere Angelegenheiten empfunden wird. Und wo sich die Chinesen stolz auf eine wohlwollende Darstellung der gemeinsamen Geschichte beziehen, blicken Europäer mit einer aus der kolonialen Schuld resultierenden Verlegenheit auf ihre früheren Beziehungen zu Afrika.
Chinas wirtschaftsorientierter Ansatz ist innerhalb und außerhalb Afrikas auf vielfältige Kritik gestoßen, der Hauptvorwurf lautet, dass Afrika durch die «Schuldenfallen-Diplomatie» neu kolonisiert werde. Peking nutze arme afrikanische Länder aus, indem es ihnen Geld leiht, wohl wissend, dass sie nicht in der Lage sind, es zurückzuzahlen. Säumige afrikanische Schuldner würden zur leichten Beute Chinas, das Vermögenswerte beschlagnahmen oder sich den Zugang zu natürlichen Ressourcen sichern wolle. Die Untersuchungen derartiger Vorwürfe ergeben bisher allerdings keine Anzeichen dafür, dass Peking bei der Kreditvergabe absichtlich auf säumige afrikanische Gläubiger spekuliert. Eine Studie zeigt, dass chinesische Kredite in Afrikas Kampf um ein tragbares Schuldenniveau nur eine geringe Rolle spielen. Darüber hinaus übersieht der Schuldenfallen-Vorwurf oft den realen Kreditbedarf und spricht dem Kontinent so pauschal eigene Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit ab.
Dennoch ist ein Teil der Kritik nur schwer von der Hand zu weisen, insbesondere, was Chinas Nichteinmischungsstrategie anbelangt. Peking hat in Afrika diplomatische Erfolge errungen, indem es sich der jeweiligen politischen Führung anbiederte, häufig auf Kosten der afrikanischen Bürger und der Zivilgesellschaft. Seine Gleichgültigkeit gegenüber den Gräueltaten in Darfur zum Beispiel wurde von einigen afrikanischen Wissenschaftlern kritisiert, die eine Verurteilung aller Beteiligten einschließlich der Chinesen forderten. In der Tat ist dies die Schattenseite einer Diplomatie, die Akteure außerhalb der Regierungen viel zu wenig zu Rate zieht – trotz seit Jahren existierender zivilgesellschaftlicher Austauschprogramme.
Die Erfahrung anderswo hat uns gelehrt, dass dieser Ansatz sowohl für China als auch für die Partnerländer kontraproduktiv ist. Der Hambantota-Hafen in Sri Lanka beispielsweise geriet auch deshalb in Verruf, weil China sich nicht für die dortige Innenpolitik interessierte. Das ehrgeizige Projekt ging vorrangig auf das Bestreben des damaligen sri-lankischen Präsidenten zurück, seiner Heimatstadt ein bombastisches Geschenk zu machen. Doch die Bedenken der dortigen Zivilgesellschaft oder anderer Akteure wurden von Peking nicht entsprechend berücksichtigt, bevor es das Projekt in Angriff nahm.
In Kenia ist die übermäßig teure Mombasa-Nairobi-Eisenbahn – gebaut mit einem chinesischen Darlehen und von einem chinesischen Unternehmen – in die Diskussion geraten. Es ist unklar, ob die größte Volkswirtschaft Ostafrikas in der Lage sein wird, die Schulden zu bedienen, und von afrikanischer Seite werden ernsthafte Fragen dazu gestellt, ob die Wirtschaftlichkeit der Eisenbahn die chinesische Seite überhaupt interessierte oder ob es nur um die allzu bereitwillige Erfüllung des Eisenbahn-Wunsches der kenianischen Führung ging. Auf dem vierten Wanshou-Forum 2018 versuchte ein Kollege aus Malawi am Beispiel des neu errichteten, hochmodernen Parlamentsgebäudes zu zeigen, wie China seinem Land hilft. Da das Thema des Forums die Armutslinderung war, fragte ich, wie das Parlamentsgebäude dazu beitragen würde, das Leben der Malawier zu verbessern. Solchen Fragen muss Peking Aufmerksamkeit schenken, bevor es Projekte in Angriff nimmt, die für Menschen in Afrika keinen direkten Nutzen haben. Das von China im April 2019 herausgegebene Dokument zur Schuldentragfähigkeit für die teilnehmenden Länder der «Belt and Road Initiative» stimmt deshalb optimistisch, signalisiert es doch, dass China nun die Risikobewertung der betroffenen Staaten mit berücksichtigt.
Unhinterfragt kann Chinas Tendenz, jegliche Kritik als westliche Propaganda zurückzuweisen, leicht dazu führen, dass die tatsächlichen Sorgen Afrikas ignoriert werden. Die weltweite Empörung über die Behandlung afrikanischer Einwanderer in der Stadt Guangzhou nach dem Coronavirus-Ausbruch Anfang des Jahres geht nicht nur auf «Missverständnisse» und «westliche Propaganda» zurück, wie es die chinesische Seite gerne behauptet. Diese Haltung geht davon aus, dass Afrikaner leichtgläubig und unfähig sind, Informationen selbst einzuordnen. Auch wenn westliche Medien das Thema weidlich ausschlachteten, äußerten Afrikaner selbst öffentlich wie über diplomatische Kanäle starke Bedenken und bestellten sogar chinesische Diplomaten ein. Eine derartige Reaktion ausschließlich auf westliche Medienberichte zurückzuführen ist abwegig.
Erschienen in maldekstra #9