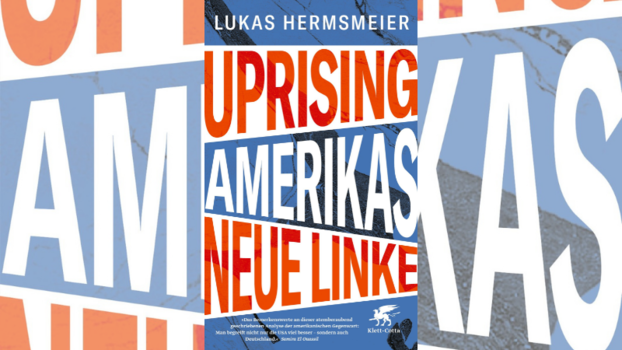
Lukas, in wenigen Tagen erscheint dein Buch «Uprising». Warum braucht Deutschland ein Buch über die US-amerikanische Linke?
Wenn man sich die vergangenen Jahre anschaut, ist es ja ziemlich offensichtlich, dass eine Radikalisierung der Rechten stattgefunden hat. Zeitgleich zu den reaktionären, ultrakonservativen und teilweise faschistoiden Tendenzen kann man aber eben auch andere Entwicklungen feststellen, eine Öffnung für linke Politik. Für deutsche Leser*innen könnte das Buch interessant sein, weil aus der extrem angespannten Lage Formationen, Programme und Zugänge zu Politik gewachsen sind, die es so in Deutschland nicht gibt. Hier tut sich sehr viel! Einiges davon ist inspirierend, denke und hoffe ich, auch wenn sich die Dinge natürlich nicht eins zu eins übertragen lassen. Ich habe außerdem den Eindruck, dass das, was sich in der US-Linken entwickelt, nur selten in Deutschland ankommt. Der Name Bernie Sanders ist den meisten bekannt, die Bewegung Black Lives Matter auch, aber was hinter diesen Namen und Slogans steht, darüber wird nur begrenzt berichtet.
Du schreibst an einer Stelle, dass die politische Polarisierung vielen Beobachter*innen Angst bereitet. Das kennen wir natürlich, wenn wir auf Trump schauen und auf die Faschisierung der Republikanischen Partei. Aber du sagst zugleich, dass die Polarisierung auch Hoffnung machen kann. Wie meinst du das?
Während der Obama-Zeit haben viele US-Amerikaner*innen festgestellt, dass die politische Mitte, dass die liberale Politik immer weniger Antworten findet auf die gesellschaftlichen Probleme – sei es die Polizeigewalt, das Gefälle zwischen Arm und Reich oder der Klimaschutz. Hoffnung sehe ich dort, wo Menschen sich zusammentun und radikal im wahrsten Sinne des Wortes handeln, also an die Wurzeln der Probleme gehen. Die Antwort auf die Rechtsverschiebung kann nicht die Fortführung der neoliberalen Politik der vergangenen Jahrzehnte sein, das spüren immer mehr Menschen. In diesem Sine gibt es eine Polarisierung und Radikalisierung, die Hoffnung auf mehr soziale Gerechtigkeit und eine funktionierende Demokratie macht. Bestimmte Konflikte müssen eben herausgestellt werden; man kann ja nicht so tun, als hätten Jeff Bezos und seine über eine Million Angestellten die gleichen materiellen Interessen.
Lukas Hermsmeier lebt als freier Journalist in Brooklyn.
Das Gespräch führte Stefan Liebich.
Du hast in deinem Buch etwas beschrieben, womit ich gerade beginne: eine Reise durch die politische Linke in den USA. Erzähl uns doch mal deine persönliche Beziehung zu dem Land: Wie bist du auf die USA gekommen und was hast du da in den letzten Jahren gemacht?
Das war vergleichsweise unoriginell: Ich bin in Berlin aufgewachsen, war der Stadt irgendwann überdrüssig, und New York wirkte auf mich diffus faszinierend. In New York hatte ich dann das Glück, sehr schnell auf interessante Leute zu treffen, die mir politische Perspektiven aufgezeigt haben, die mir zuvor eher fremd waren. Ich hatte mich etwa nie mit der Idee befasst, wie eine Gesellschaft ohne Polizei und Gefängnisse aussehen könnte. Dann habe ich mit einem linken Schwarzen Autor zusammengewohnt, der mit mir darüber gesprochen hat. Das hat meine bürgerliche Identität kräftig durchgerüttelt. Seit 2014 lebe ich also in Brooklyn, arbeite als Reporter für deutsche Zeitungen und Magazine, und fahre dabei so oft es geht an andere Orte des Landes.
Ich erinnere mich daran, dass ich bei einer meiner ersten Reisen als Bundestagsabgeordneter in den USA davon sprach, dass ich demokratischer Sozialist sei. Da ist mein Gesprächspartner aus dem Kongress beinahe in Ohnmacht gefallen. Ich habe dann gesagt: «So ähnlich wie Bernie Sanders.» Aber das machte es kaum besser. Inzwischen hat sich das offenbar geändert. Jetzt gibt es viele Menschen, die sich als demokratische Sozialist*innen bezeichnen. Kürzlich traf ich etwa in einer Kleinstadt in Pennsylvania eine alleinerziehende Mutter, die sich in der Elternvertretung engagiert und von sich sagt, sie sei demokratische Sozialistin. Dabei war sie vor ein paar Jahren noch Republikanerin. Was ist passiert in dem Land?
Es ist beides: eine neue Entwicklung und eine Rückkehr des US-Sozialismus. Eine Rückkehr deshalb, weil es Anfang des 20. Jahrhunderts sowohl die Socialist Party als auch die Communist Party gab, die jeweils rund 100 000 Mitglieder hatten. So stark sind die Democratic Socialists of America (DSA), die größte sozialistische Organisation, jetzt auch wieder, wobei man dazu sagen muss, dass die Bevölkerung heute auch drei Mal so groß ist. Grob gesprochen kann man den Aufschwung der sozialistischen Bewegung durch zwei Faktoren erklären. Zum einen haben sich in fast allen gesellschaftlichen und politischen Bereichen die Verhältnisse zugespitzt, die Verarmung – auch von Leuten aus der Mittelschicht – ist gestiegen. Viele junge Sozialist*innen arbeiten heute als Grafikdesigner, Lehrerin, Pflegekraft und leben oftmals am Rande der Prekarität. Die Zahl der inhaftierten Amerikaner*innen ist in den vergangenen vier Jahrzehnten um 500 Prozent gestiegen, über allem ragt der Klimawandel. Dabei wurde für viele Menschen deutlich, dass die alten Antworten – jene aus der Obama-Zeit, über die ich vorhin sprach – nicht mehr helfen. Als 2015/16 Trump auf der rechten Seite des politischen Spektrums auftauchte, erschienen auch auf der linken Seite neue Akteure. Einerseits zeigte Trump, wohin eine Gesellschaft, die für sich in Anspruch nimmt, eine Demokratie zu sein, driften kann. Andererseits sprach Bernie Sanders ganz anders über Politik, als man es von den Etablierten kannte, etwa über die Klassengesellschaft, und rief die Arbeiterinnen und Arbeiter dazu auf, sich als solche zu identifizieren. Für viele gab es also einen Moment von «Sozialismus oder Barbarei», wie Rosa Luxemburg das genannt hatte.
Ich sprach kürzlich mit der Historikerin Judith Goldstein. Aus ihrer Sicht ist der Rassismus nach wie vor das entscheidende Problem, mit dem sich vieles erklären lässt, beispielsweise der Zustand der Republikanischen Partei. Welche Rolle spielt der Rassismus in den USA aus deiner Sicht?
Eine gewaltige, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist der auch Grund, warum Polizeigewalt, der Widerstand gegen diese Institution sowie die Frage, wie man sie überwinden kann, eine so wichtige Rolle für die Linke in den USA spielen – und daher auch in meinem Buch. In Kapitel 3 und 6 geht es um den Abolitionismus, also die Idee einer Gesellschaft, die keine Gefängnisse und Polizei braucht. Als Begriff und Konzept bezieht sich der Abolitionismus historisch auf die Anti-Sklaverei-Bewegung. Heute steht dahinter die Überzeugung, dass es nicht hilft, die Polizei professioneller zu machen oder die Beamt*innen mit Bodycams auszustatten. Stattdessen sollte – so lautet die These der Abolitionist*innen von heute – der Kontakt zwischen Polizei und Bürger*innen radikal reduziert werden. Die Polizei hat beispielsweise eine große Präsenz in Schulen und Krankenhäusern, was wir in Deutschland so gar nicht kennen. In den USA ist das Thema also größer, weil die Polizei größer ist. Das Gleiche gilt für den Gefängnis-Komplex: In den USA sitzen über zwei Millionen Menschen hinter Gittern, das sind komplett andere Maßstäbe. Beim Abolitionismus geht es aber längst nicht nur um den Abbau des Strafapparats, sondern um eine Utopie, einen Horizont, der mit dem Aufbau neuer Sozialstrukturen zu tun hat, wie mir unter anderen Rachel Herzing erklärt hat, die zusammen mit Angela Davis die Organisation «Critical Resistance» gegründet hat. Die gegenwärtige abolitionistische Bewegung ist stark von marxistischen Schwarzen Frauen geprägt, die den sogenannten Prison Industrial Complex, also das im Strafvollzug bestehende Konglomerat aus Exekutive und Privatinteressen, als Erste kritisierten. Der Slogan «Defund the police» (der Polizei die finanziellen Ressourcen entziehen), der im Frühsommer 2020 plötzlich Schlagzeilen machte, ist ein Denkanstoß in diese Richtung. Aber der Slogan wird innerhalb der Bewegung auch kritisch betrachtet, weil es ja in erster Linie nicht um Mittelabzug geht, sondern eben um den Aufbau einer anderen Gesellschaft. Das ist die zentrale Botschaft.
Du sprichst im Buch auch die Lage der Indigenen, der Native Americans, an und ihren Konflikt mit der Ölindustrie. Wie stark ist ihr Kampf mit den Kämpfen der Linken verbunden?
Sie sind vernetzt und es gibt eine wachsende Solidarität, aber viele Indigene fühlen sich zurecht oft im Stich gelassen. Deswegen schreibe ich in meinem Buch über den Kampf in Standing Rock 2016, wo man das beobachten konnte, was der Geograph Zoltán Grossman «unwahrscheinliche Allianzen» nennt: eine Verschwisterung zwischen indigenen und weißen Aktivist*innen. Bei Standing Rock handelte sich um massive Proteste gegen eine Ölpipeline, deren Bau auch mit Donald Trump verknüpft war. Die Proteste gingen zunächst von den indigenen Gemeinschaften in North Dakota aus, aber im Laufe des Jahres haben viele Linke aus verschiedenen Regionen der USA am Protest teilgenommen. In der Spitze waren es 15 000 Menschen, Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) reiste beispielsweise aus New York City an. Irgendwann kamen auch die Fernsehkameras, es gab eine Aufmerksamkeit, wie sie viele Indigene vorher nie erfahren hatten. Ihr Widerstandskampf wurde lange ignoriert, aber es tut sich etwas. Ich erlebe inzwischen bei Veranstaltungen und Protesten in Großstädten, dass die indigene Kritik und ihr Verhältnis zu Natur und Boden viel mehr mitgedacht wird.
Ich habe vor einigen Jahren an einer Konferenz in Harvard teilgenommen, und da sagte ein Gast aus Kanada, es sei bei ihnen mittlerweile üblich, dass man am Veranstaltungsbeginn erklärt: Wir befinden uns auf dem Territorium – und dann wird der Name des Volkes genannt, das früher dort lebte.
Als ich das zum ersten Mal erlebte, war ich im besten Sinne irritiert. Ich wusste natürlich ein wenig um die indigene Geschichte, aber eben nur oberflächlich. Sich damit auseinanderzusetzen, was dort war, wo man heute lebt, scheint mir ein guter Anfang.
Du hast den Kampf der Ölindustrie gegen die Interessen der Menschen, die in diesen Gebieten leben, erwähnt. Wie ist es generell mit Blick auf die Klimabewegung? In Deutschland gibt es «Fridays for Future», die Partei DIE GRÜNEN, die nun auch Teil der Bundesregierung ist. Was sind die Unterschiede zwischen der deutschen und der amerikanischen Klimabewegung?
In den USA gab es keinen Massenstreik von Schüler*innen, aber auch hier sind es überwiegend junge Menschen, die sich der Klimabewegung angeschlossen und radikalisiert haben. «System change, not climate change» ist einer der Slogans, was natürlich auch eine hohle Phrase bleiben kann, aber immer mehr junge Menschen sehen, dass die Erde nicht mit E-Autos und veganem Essen gerettet wird. Die Ökonomie muss transformiert werden, neue Infrastruktur entstehen. Und da gibt es Parallelen zwischen «Sunrise Movement» und «Fridays for Future». Ein Unterschied ist, wie du sagst, dass es in Deutschland eine grüne Partei gibt, die im Establishment angekommen ist. Die gibt es in den USA nicht. Auch die Demokraten standen dem Klimawandel in den letzten Jahrzehnten ziemlich gleichgültig gegenüber. Insofern ist die Klimabewegung in den USA noch klarer außerparlamentarisch ausgerichtet, und wohl noch klarer Anti-Establishment.
Du widmest dich am Beispiel von Amazon in Bessemer, Alabama, auch dem Kampf der Arbeiterinnen und Arbeiter gegen das Kapital. Der Kampf für gewerkschaftliche Organisierung schien dort zunächst verloren, ist jetzt aber doch wieder offen. Ist das ein Einzelfall? Oder siehst du eine breitere Bewegung für gewerkschaftliche Organisierung und höhere Löhne in der Arbeiterschaft?
Ich sehe einen Aufschwung, auch wenn die Arbeiterbewegung noch sehr weit von ihrer früheren Kraft entfernt ist. 2018 gab es eine Streikwelle, die u.a. von Lehrer*innen angeführt wurde, im vergangenen Oktober unter dem Stichwort «Striketober» – mit Kämpfen bei Kellogg’s, John Deere, Starbucks u.a. – eine weitere. Wenn man das mit 1919 oder 1945/1946 vergleicht, ist es immer noch klein. Aber im Vergleich zu den letzten zehn Jahren tut sich eine Menge. Ein Problem ist, dass die Kämpfe immer noch sehr fragmentiert sind – was allerdings auch kein Wunder ist, nach 40 Jahren Gewerkschaftsbekämpfung, Privatisierung, Outsourcing usw.
Die Kampfbedingungen sind für die Arbeiterklasse in den USA wegen der furchtbar gewerkschaftsfeindlichen Gesetzgebung sehr schlecht. Dagegen gibt es jetzt erfreulicherweise auch im US-Kongress neue Gesetzesvorhaben. Das führt mich zu dem Thema Demokratische Partei. Im US-Zweiparteiensystem ist das eine Organisation, die von AOC bis zu Joe Manchin reicht. Wie schaust du auf diese Partei? Gibt es aus deiner Sicht eine Linksverschiebung?
Die Demokraten haben in den letzten Jahrzehnten immer wieder eine fatale Rolle gespielt. Ihre führenden Kräfte, Vertreter*innen der politischen Mitte, sind an einem großen Teil der negativen Entwicklungen in diesem Land beteiligt. Ich denke da zum Beispiel an Bill Clintons Crime Bill in den 90er Jahren, die dazu geführt hat, dass so viele Schwarze Amerikaner*innen wegen kleinster Vergehen im Gefängnis gelandet sind. Dass es der Arbeiterbewegung in den letzten Jahrzehnten immer schwerer gemacht wurde, sich zu organisieren, ist Resultat auch demokratischer Politik. Eine der Lehren, die die US-Linke hieraus gezogen hat, lautet: Wir können uns nicht auf diese Partei verlassen, sie wird nicht in unserem Sinne handeln. Das Bild, dass die Democrats wie ein großer Schirm funktionieren, unter dem sich viele Haltungen versammeln, stimmt zwar: von Bernie Sanders bis zu Joe Manchin, bei dem man sich fragt, warum der Mann nicht bei den Republikanern ist. Die Gruppe linker Kongressabgeordneter ist aber immer noch klein. Zum sogenannten Squad gehören nur sechs Leute in einem Parlament von 435. Der Kern und die Spitze der Partei sind liberal-konservativ. Dass sich manche Dinge in die progressive Richtung verschoben haben, wurde vor allem durch Druck von außen erreicht, durch jahrzehntelange Arbeit linker Organisationen. Und es hat auch mit der Popularität von Bernie Sanders zu tun – wer so viel Unterstützung erhält, den kann man nicht einfach ignorieren. Joe Biden und Nancy Pelosi haben bestimmte Reformen, wie die Streichung der Schulden aus Studiengebühren, lange ignoriert oder verhindert, öffnen sich aber wegen des wachsenden Drucks in manchen Fragen. Was das im Ergebnis für die Midterm Elections, die Zwischenwahlen im November, bedeutet, ist offen. Werden die Wähler*innen Verbesserungen ihres Lebens mit dieser Präsidentschaft verbinden oder werden sie sich wieder von den Demokraten abwenden?
Du erwähnst in deinem Buch den erfolgreichen Kampf gegen das Vorhaben von Amazon, die neue Konzernzentrale in Queens zu errichten, und schlägst den Bogen zu «Deutsche Wohnen & Co. enteignen» in Berlin. Was können die US-amerikanischen Linken von deutschen Linken und was können deutsche Linke von US-Linken lernen?
Ich glaube, dass man eine Menge vom «Organizing» der US-Linken lernen kann, das fast alle linken Kollektive verfolgen. Im Kern geht es darum, dass man die Bürger*innen selbst zu politischen Akteuren macht und sie nicht nur zu Wahlen mobilisiert oder als Konsument*innen von Politik sieht. Dass man eine Basis rund um konkrete Forderungen schafft und Druck ausübt. Durch solche Formen des Organizings ist es ja auch der Initiative «Deutsche Wohnen & Co. enteignen» gelungen, über eine Million Berliner*innen hinter sich zu versammeln. Man müsse «raus aus der Szene, rein in die Klasse», sagte mir kürzlich eine linke Berliner Organizerin, und das bringt es gut auf den Punkt. Man muss schon aus seiner Bubble raus, wenn man etwas bewegen will.
Das war ein schönes Schlusswort, Lukas. Dein Buch leistet meines Erachtens einen wichtigen Beitrag zum Verständnis der US-Linken, ich wünsche ihm deshalb viele Leserinnen und Leser. Vielen Dank auch für das Interview – wir bleiben im Gespräch.