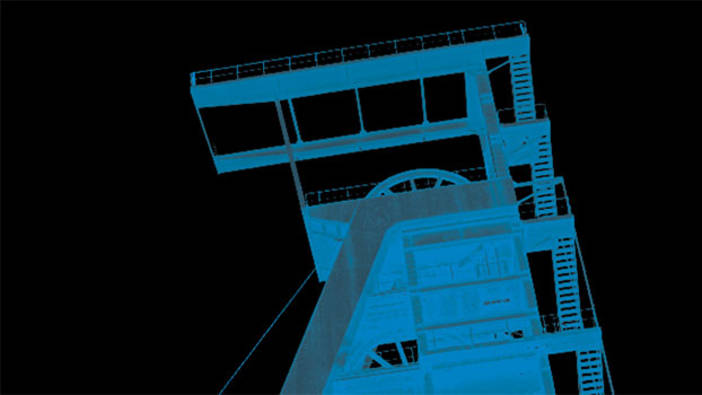Die Geschichte der DDR ist noch nicht auserzählt, könnte man meinen. Der MDR hatte in seinem literarischen Jahresrückblick 2022 acht lesenswerte Bücher über die DDR empfohlen. Und auch in diesem Jahr sind bereits mehrere neu dazugekommen. Liest Du noch Bücher darüber, wie die DDR war oder auch, wie sie gewesen sein soll?
Daniela Trochowski: Ehrlich gesagt, hatte ich mir in den Jahren nach der Wende weitgehend abgewöhnt, Bücher und vor allem Artikel über die DDR zu lesen, die hier auf dem Medien- oder Büchermarkt erschienen sind. Das lag vor allem daran, dass das, was da geschrieben stand, nicht annähernd mit meinen Erfahrungen und Perspektiven übereinstimmte. Ich hatte oft das Gefühl, dass da die Sicht westdeutscher Autor*innen verbreitet wurde über etwas, das sie nicht erlebt hatten und mit dem sie nichts verband. Nun muss man Ereignisse nicht selbst erlebt haben, um über sie zu schreiben, sollte aber durchaus eine sachliche und von Fakten geleitete Herangehensweise pflegen, wenn man meint, eine Bewertung abgeben zu müssen oder zu richten. Und das ist eben, glaube ich, genau das Problem, dass in der öffentlichen und politischen Debatte über uns Ostdeutsche gerichtet, über uns statt mit uns gesprochen wurde und wird.
Daniela Trochowski ist seit 2020 Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Davor (ab 2009) war die Diplom-Volkswirtin Staatssekretärin des Ministeriums der Finanzen des Landes Brandenburg.
Ich hatte mir in den Jahren nach der Wende eine ehrliche gesellschaftliche Debatte, mindestens in den ostdeutschen Bundesländern, darüber gewünscht, warum die DDR gescheitert ist, wie es zu Stalinismus, Personenkult und fehlender Freiheit kommen konnte und was vor allem auch mein persönlicher Anteil an all dem war – etwa durch eigenes Tun oder Unterlassen. Wenn man so will – eine Wahrheitskommission, die wir Ostdeutschen in eigener Regie durchgeführt hätten. Diese Diskussionen hat es, bis auf wenige Orte wie zum Beispiel in der damaligen PDS, hier in der Stiftung oder auch in meinem privaten Umfeld, nicht gegeben. Das ist sicherlich kein Zufall, denn letztlich geht es bis heute um die Deutungshoheit über ein gesellschaftspolitisches Experiment, das des Sozialismus. Wenn wir erkennen, warum er gescheitert ist, können wir aufzeigen, wie er besser gelingen könnte. Diese politische Debatte ist eben durch den politischen Mainstream nicht gewollt.
Die Geschichte der DDR kann aber auch die DDR selbst ausgezeichnet erzählen. Ich habe gerade nach der Wende bis heute zahlreiche Bücher aus der DDR selbst gelesen, die sich kritisch mit den politischen Verhältnissen auseinandersetzten oder einfach darüber, wie sich dieser Sozialismus erträumt wurde: Günter de Bruyn, Stefan Heym, Anna Seghers oder ja auch Schriftsteller wie Erik Neutsch oder Dieter Noll sind da immer eine gute Adresse.
Die Ostdeutschen müssen die Hoheit über ihre eigenen Geschichten bekommen.
In «Der Osten: eine westdeutsche Erfindung» vertritt der Autor Dirk Oschmann die These, dass der Westen den Osten als negative Projektionsfläche braucht, um sich selbst in einem besseren Licht darzustellen. Nachvollziehbar oder zu kurz gegriffen?
Ich würde gar nicht meinen, dass das die Hauptthese von Oschmann ist. Er selbst hat kürzlich in einem Interview betont, dass es «den Westen» aus seiner Sicht auch nicht gibt. Er spricht vom Nicht-Vorkommen, Ausgrenzen, Diskriminieren einer großen Bevölkerungsgruppe, den Ostdeutschen. Damit hält er natürlich denen, die die Vereinigung politisch gestaltet und durch öffentliche Darstellung begleitet haben, den Spiegel vor. Und ich meine, alles was er schreibt ist richtig. Es ist nicht nur selbst erlebt, sondern durch Fakten belegt: Ostdeutsche kommen in allen wirtschaftlichen und öffentlichen Bereichen in Führungspositionen nahezu gar nicht vor, sie verdienen bis heute – eine Generation nach der Wende! – viel weniger Geld und bekommen weniger Rente. Die Frage ist doch, tun wir endlich etwas mit diesen Erkenntnissen? Aus meiner Sicht müssen diese Konflikte nach vorn aufgelöst werden. Es geht in Zukunft weniger ums Anklagen als ums Aufarbeiten der Fehler der Vereinigung und um das Abstellen genau dieser. Teilweise hat das ja bereits begonnen. Ich habe im vergangenen Jahr an einer Veranstaltung des Bundesfinanzministeriums teilgenommen, in der die Ergebnisse eines vom BMF geförderten Forschungsprojekts zur Arbeit der Treuhand-Anstalt vorgestellt wurden. Da wurden von den Wissenschaftlern kritische Aspekte benannt. Allerdings lief diese Veranstaltung leider nach dem vertrauten Muster ab: Der Wissenschaftler stellt kurz seine Ergebnisse vor und (ehemalige) Politiker – es waren tatsächlich alles Männer! –, wie der Finanzminister Lindner, Karl-Heinz Paque oder Richard Schröder dominieren die Debatte mit ihrer Sichtweise. Von Betroffenen oder Menschen, die in der Wirtschaft der DDR selbst Verantwortung hatten, auf dem Podium keine Spur. Das muss sich endlich ändern! Die Ostdeutschen müssen die Hoheit über ihre eigenen Geschichten bekommen. Ich würde eher dies als Hauptthese von Oschmann sehen.
In diesem Jahr begehen wir 33 Jahre deutsche Einheit. Aber, das Land ist nach wie vor gespalten – wirtschaftlich, politisch, kulturell. Was ist schiefgelaufen?
Wenn ich boshaft wäre, würde ich unverblümt sagen: Ein Beitritt ist eben ein Beitritt. Niemand hat uns Ostdeutschen 1990 versprochen, dass hier ein gemeinsames Projekt auf den Weg gebracht wird, das wir mitgestalten können. Ich selbst habe als Studentin in Leipzig mit meinen Freunden mit Transparenten demonstriert, auf denen stand «Nie wieder Deutschland!». Uns hat die ganz konkrete Angst umgetrieben, dass wir uns plötzlich in einem Land wiederfinden sollten, dass niemals mit dem Faschismus aufgeräumt hatte.
Dass die gesamte politische Klasse Westdeutschlands faktisch auch einen Beitritt meinte, auch wenn von Vereinigung gesprochen wurde, wurde uns in allen gesellschaftlichen Bereichen ab Mitte 1990 knallhart gezeigt: An den Universitäten, ich habe zu dieser Zeit in Leipzig studiert, wurden über Nacht Lehrstoff und Professor*innen ausgetauscht, in Betrieben, wenn sie offen blieben, die Leitungen ausgetauscht, die Verwaltungen aufgelöst, Lehrer*innen entlassen und und und. Das lief in den ostdeutschen Bundesländern sicherlich in unterschiedlicher Ausprägung ab, aber der Grundtenor bleibt: Menschen wurden nicht nach ihrer Kompetenz, sondern nach ihrer Herkunft bewertet. Darüber hinaus wurde uns Ostdeutschen ja relativ zügig nach der Wende an einer anderen Stelle vorgeführt, dass wir eben beigetreten waren: Der Idee des Runden Tisches für eine neue Verfassung, gemeinsam erarbeitet, und für eine neue Hymne, der Kinderhymne von Brecht, wurde mit dem Beitritt eine Absage erteilt. Wir leben noch heute mit einem Grundgesetz, dass ja eigentlich nur für die Zeit der Teilung erarbeitet war. Die Ostdeutschen mussten darüber hinaus sehr schnell auch um ihre Häuser oder Grundstücke fürchten, denn am Grundsatz «Rückgabe vor Entschädigung» war nicht zu rütteln. Oder ein weiteres Beispiel von unzähligen, die man nennen könnte: Vielfach wird beklagt, dass Ostdeutsche bis heute nicht in Führungspositionen der öffentlichen Verwaltungen vorkommen. Ich habe als Staatssekretärin im Finanzministerium Brandenburgs eine Ursache dafür erfahren: Die zumeist abgeforderte Qualifikation der Jurist*in mit Befähigung zum Richteramt, setzt ein Jurastudium mit zweitem Staatsexamen voraus, das Ostdeutsche meiner Generation und älter gar nicht haben, da es in der DDR das Studium der Diplomjurist*in gab. Damit wurden und werden alle Ostdeutschen ausgeschlossen. Den Verwaltungsjurist*innen, meist «Aufbauhelfer*innen» aus NRW war genau dieser Sachverhalt immer sehr bewusst und trotzdem, oder vielleicht deshalb?, benötigte ich als Amtschefin Jahre, um diese Praxis zu ändern. Ich habe 2018, also 28 Jahre nach der Wende, die erste ostdeutsche Abteilungsleiterin eingesetzt!
Aber selbst, wenn man akzeptieren würde, dass ein Beitritt der DDR in die Bundesrepublik damals der gewollte Akt war, gibt es für die vorhandenen wirtschaftlichen und sozialen Diskrepanzen keine Begründung. Warum werden noch heute überhaupt Tarifverträge abgeschlossen, in denen Menschen – nur, weil sie in einem bestimmten Teil des Landes arbeiten und leben – geringere Gehälter bekommen? Das Problem ist dabei, dass sich allein dieser Umstand auf alle anderen wirtschaftlichen, sozialen und finanzwirtschaftlichen Bereiche der Gesellschaft auswirkt: Die Ostdeutschen haben aufgrund geringerer Gehälter geringere Renten, die ostdeutschen Bundesländer und Kommunen haben geringere Steuereinnahmen. Insgesamt werden auf diese Weise Abhängigkeiten vom «Westen» konserviert und der «Osten» immer wieder in den Bettelstatus verwiesen. Klar ist auch, dass jedes Land, in dem wir derart ungleiche materielle Lebensverhältnisse vorfinden, tief gespalten ist. In anderen Ländern können wir diese Spaltung entlang von ethnischer oder religiöser Zugehörigkeit beobachten. Und wir beobachten, dass dies immer zu Konflikten, in manchen Ländern sogar zu Bürgerkriegen geführt hat.
Der Sturz der DDR war ein hoch demokratischer Vorgang!
Im Osten gibt es aus historischer Erfahrung oft andere Ansichten. Die Regierung antwortet mit dem Vorwurf der Demokratieunfähigkeit. Wie siehst Du das?
Ostdeutsche sind meiner Meinung nach genau so «demokratiefähig» oder «-unfähig» wie Westdeutsche. Interessanterweise erinnern an den üblichen Jahrestagen immer dieselben Leute – Politiker*innen, Wissenschaftler*innen oder Journalist*innen – daran, dass die Ostdeutschen die DDR durch eine friedliche Revolution, durch auf die Straße gehen!, zu Fall gebracht haben, die den Ostdeutschen bei anderen Gelegenheiten mangelnde Demokratiefähigkeit vorwerfen. Der Sturz der DDR war ein hoch demokratischer Vorgang! Im Übrigen war bei diesen Montagsdemos, zum Beispiel in Leipzig, ein Höchstmaß an zivilem Ungehorsam der Demonstrierenden im Spiel, der zumindest in der ersten Zeit unglaublichen Mut erforderte. Was wir Ostdeutschen dann nach 1990 erlebten – nämlich die Perspektive von 17 Millionen Menschen auszuschließen und sie wirtschaftlich und sozial abzuhängen – war nach meinem Dafürhalten nicht gerade demokratisch. Zumindest wenn man unter Demokratie mehr versteht, als zur Wahl zu gehen.
Und genau das ist aus meiner Sicht der Punkt: Das Verständnis von Demokratie. Sie ist ja kein Zustand der vom Himmel fällt oder den Bürger*innen vom Staat und der Politik geschenkt wird. Sie ist, und das wird aus meiner Sicht von den Kritikern der Ostdeutschen oft übersehen, auch nicht mit dem Staat gleichzusetzen. Demokratie ist ein Zustand, in dem Bürger*innen ihre Gestaltungsmacht nicht nur an Parlamente delegieren können sollten, sondern auch weitgehend die Möglichkeiten haben, diese für die direkte Gestaltung ihres Umfeldes und gesellschaftlicher Bedingungen einzusetzen, und das durchaus auch bei globalen Themen. Und da Demokratie immer Rückschläge durch staatliches Handeln erleiden kann, sich Bürger*innen diese immer wieder aufs Neue erkämpfen müssen, ist Demokratie aus meiner Sicht auch ein immer währender Prozess. Das wird im Zusammenhang mit dem Thema «Demokratieunfähigkeit» leider sehr oft vergessen. Darüber hinaus gehört zum Gestalten einer Gesellschaft natürlich auch, dass wir unsere Unzufriedenheit mit den realen wirtschaftlichen oder sozialen Grundlagen zum Ausdruck bringen und diese ändern wollen. Das ist das Gegenteil von Unfähigkeit zur Demokratie!
Interessanterweise haben die Ostdeutschen in der DDR – und auch das gehört zur Wahrheit – durchaus damit Erfahrung gemacht, ihre unmittelbaren Lebensbedingungen mitgestalten zu können. Mein Vater hat mir erst vor kurzem ein Beispiel aus unserem unmittelbarem Lebenszusammenhang erzählt: Als wir 1975 wie so viele andere in ein neues Wohngebiet im damaligen Karl-Marx-Stadt zogen, sollte in den in unserer Nachbarschaft leerstehenden «Würfel» eine Wäscherei untergebracht werden. Im Wohngebiet gab es ein Komitee aus Einwohner*innen und Arbeiter- und Bauern-Inspektion, das sich nach Umfragen unter den Nachbar*innen erfolgreich für die Einrichtung einer Wohngebietskneipe stark machte. Die war dann ein voller Erfolg, wie ich aus eigener Erfahrung sagen kann! Mir liegt es fern zu behaupten, die DDR wäre ein Land gewesen, in dem Demokratie herrschte. Im Gegenteil. Aber möglicherweise waren die Erwartungen der Ostdeutschen an die bundesrepublikanische Demokratie sehr hoch und sie mussten dann eben erfahren, an den Rand gedrängt und in der Gesellschaft nicht wahrgenommen zu werden und Dinge, die für sie wichtig waren nicht mitbestimmen zu können. Das, obwohl sie ja eben aufgrund ihrer anderen Erfahrungen viel zu sagen hatten.
Mit einem Fakt kann ich mich jedoch nicht abfinden und bin hier noch immer auf der Suche nach Antworten: Der große Erfolg der AfD in einigen ostdeutschen Bundesländern. Mir will einfach nicht in den Kopf, warum bei all den Ungerechtigkeiten und Defiziten, die es im Zuge der Vereinigung gab und immer noch gibt, ausgerechnet eine faschistische Partei, die bei diesem Thema ausschließlich auf Ressentiment setzt, im Bundestag sogar alles, was zu wirtschaftlicher und sozialer Gleichbehandlung der Ostdeutschen führen würde, ablehnt, für so viele Ostdeutsche ein politischer Favorit ist. Klar ist, dass die AfD von uns immer wieder damit konfrontiert werden muss, dass sie bei Thema «Ostdeutschland» nicht die Partei ist, die die Ostdeutschen in der Bundespolitik tatsächlich vertritt.
Die Kontroverse um die Deutungshoheit treibt manchmal seltsame Blüten. Während das Agieren der Treuhandanstalt im Osten immer noch ein großes Thema ist, verleumdet die Springer-Presse unsere Wanderausstellung als «verfassungswidrige Propaganda». Wider besseres Wissen oder manipulativer Vorsatz?
Naja, im Hause Springer meint man ja auch, wir Ostdeutschen wären entweder Faschisten oder Kommunisten – da kann man sich dann etwas aussuchen. Das ist ja nicht die erste Entgleisung in den letzten drei Jahrzehnten in Bezug auf Ostdeutschland. Man darf auch nicht vergessen, dass die Springer-Presse in der Geschichte der BRD seit ihrem Bestehen ihr reaktionäres Unwesen getrieben, lange braunes Erbe gepflegt und gegen jedweden Fortschritt gekämpft hat. Und dabei haben die Springer-Medien durchaus Menschen auf dem Gewissen. Die sollten nicht Kriterium unserer Aktivitäten sein. In Bezug auf den Osten geht es für sie um das Monopol, die Geschichte der DDR auf ihre reaktionäre Weise zu erzählen und gesellschaftlich zu platzieren. Das ist ihnen in den vergangenen Jahren leider gut gelungen. Nur bekommt diese Erzählung jetzt Risse. Durch Bücher, wie das von Dirk Oschmann und ja, auch durch Aktivitäten wie unsere Treuhand-Ausstellung. Hier haben wir Biografien von Betroffenen der Treuhand-Politik ins Licht der Öffentlichkeit gerückt. Deshalb ist die Ausstellung so erfolgreich und wird gleichzeitig so gehasst und bekämpft. Die Springer-Artikel sollten uns eher anspornen, auf diesem Weg weiter zu gehen.
Eines sollten wir nicht vergessen: Diese Gesellschaft ist zutiefst gespalten.
Ist mehr und/oder bessere politische Bildung ein Weg, um die Spaltung zu überwinden?
Eines sollten wir nicht vergessen: Diese Gesellschaft ist zutiefst gespalten, die Frage der Ostdeutschen ist aus meiner Sicht eine weitere Erscheinung dessen. Die Gesellschaft ist vor allem gespalten in Arm und Reich, in Menschen mit immensen Vermögen und die tief verschuldet sind, in Menschen, die unglaubliche Gehälter kassieren und in diejenigen, die hart unter prekären Bedingungen am Rande des Existenzminimums arbeiten. Viele konnten und können ihre Geschichten der Ausbeutung, Ausgrenzung und der Diskriminierung nicht erzählen. Davon sind auch viele Menschen mit Migrationsgeschichte betroffen. Wir sind ein linker Träger politischer Bildung und sollten eben deshalb, diese Spaltung und ihre Ursachen aufzeigen und vor allem Perspektiven und Mittel der Veränderung anbieten. Letzteres auf kurze Sicht und in der langfristigen Dimension. Bezogen auf die Debatte zu Ostdeutschland heißt das für mich ehrliche Geschichtsarbeit, sowohl in Bezug auf die DDR selbst als auch auf den Vereinigungsprozess, Menschen Gehör verschaffen, die ihre Geschichten erzählen wollen und klares und lautstarkes Eintreten für gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen.
Siehst Du die Chance einer jähen Veränderung der Verhältnisse?
Ehrlich – angesichts der Erfahrungen der letzten 33 Jahre sehe ich diese Chance nicht. Wir sind jetzt eine Generation nach der Wende und müssen diese krassen Ungleichheiten noch immer konstatieren und Angleichung einfordern. Das ist ein Skandal! Es darf nicht noch einmal Jahrzehnte dauern. Die Hoffnung, die bei Manchem vielleicht dahintersteckt, dass bald ohnehin kaum noch Menschen mit einer ostdeutschen Erlebniswelt in der Bundesrepublik leben, ist trügerisch. Denn auch wenn diese ostdeutsche Herkunft zunehmend verschwimmt – was bleibt, ist eine große Region in der Bundesrepublik, die in Bezug auf die Einkommen, Renten, damit die öffentlichen Finanzen und realen Lebensbedingungen abgehängt ist. Und dies in einem Land, in dem das Grundgesetz gleichwertige Lebensverhältnisse vorgibt. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, weil es nicht nur soziale und wirtschaftliche, sondern auch demokratietheoretische Aspekte berührt. All diejenigen in Politik und Gesellschaft, die den Ostdeutschen mangelnde Demokratiefähigkeit andichten, sollten sich also vielmehr aufmachen und gleichwertige Lebensbedingungen fordern oder diese schaffen. Und zwar zügig.