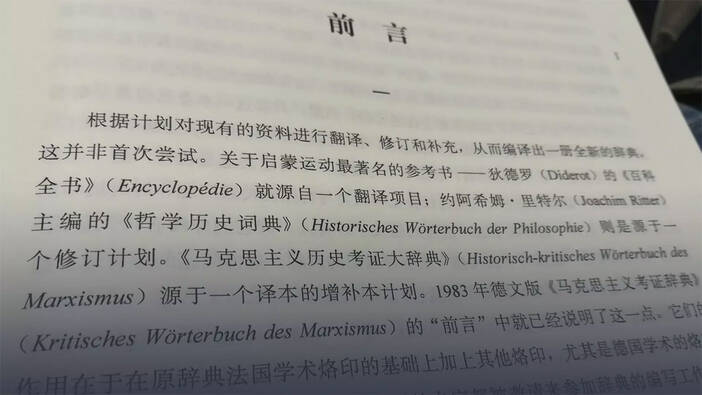Das Historisch-kritische Wörterbuch des Marxismus (HKWM) ist ein marxistisches Lexikon, das nach seiner Fertigstellung 15 Bände und über 1.500 Einträge umfassen wird. Von den bisher erschienenen neun Bänden in deutscher Sprache sind seit 2017 zwei Bände in chinesischer Sprache herausgegeben worden. Im Frühjahr 2019 hat die Rosa-Luxemburg-Stiftung gemeinsam mit dem HKWM-Team die «Internationalisierung» des Lexikons auf Englisch und Spanisch vorangetrieben, um eine neue Generation marxistischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der ganzen Welt für das Projekt zu gewinnen und seine Leserschaft und Reichweite zu vergrößern. Der unten stehende Eintrag ist Teil einer Auswahl dieser Übersetzungen, die auf unserer Website zur Verfügung gestellt werden.
Weitere Informationen über das Projekt und andere übersetzte Lexikon-Einträge finden sich in unserem HKWM-Dossier.
A: al-thaura al-ṣīnīya. – E: chinese revolution. – F: révolution chinoise. – R: kitajskaja revoljucija. – S: revolución china. – C: Zhongguo geming 中国革命
Seit seiner Verwendung durch Marx und Engels umfaßt der Begriff cR jeweils unterschiedliche Inhalte. Im weitesten Sinne wird er als allgemeine Bezeichnung der Transformation der chinesischen Gesellschaft seit ca. 1840 bis 1949 benutzt; im engeren Sinne bezieht er sich auf einzelne Entwicklungsetappen innerhalb dieses Zeitraumes, denen revolutionäre Qualität zugesprochen wird (Taiping-Revolution, Revolution von 1911, 1925-1927).
1. Die Einbeziehung Chinas in den kapitalistischen Weltmarkt seit den 1840er Jahren führt bei Marx und Engels zu Überlegungen über die welthistorische Bedeutung dieser Tatsache für revolutionäre Prozesse in Westeuropa. Sie knüpfen an die durch die Aufklärung (Voltaire, Montesquieu, Herder), die klassisch-idealistische Philosophie (HEGEL) und die klassische politische Ökonomie (Smith, James Mill) tradierten Vorstellungen eines »statischen« und »despotischen« China an, stellen jedoch in prononciertem Gegensatz zu deren Schlußfolgerungen und zum damals vorherrschenden europäischen Chinabild die Prognose einer revolutionären Umgestaltung der chinesischen Gesellschaft.
Die seit 1848 nur gelegentliche Erwähnung Chinas im Kontext der kapitalistischen Expansion wird ab 1850 durch zumeist skizzenhafte Analysen der Entwicklung in China, vor allem des Taiping-Aufstandes und der Auswirkungen der Einbeziehung Chinas in den kapitalistischen Weltmarkt, ergänzt. »Die chinesische, auf der Handarbeit beruhende Industrie erlag der Konkurrenz der Maschine. Das unerschütterliche Reich der Mitte erlebte eine gesellschaftliche Krise. [...] Das Land kam an den Rand des Verderbens und ist bereits bedroht mit einer gewaltigen Revolution.« (MEGA 1.10, 219; MEW 7, 2210 Marx sieht darüber hinaus in den egalitären Forderungen der Taiping-Bewegung angesichts der Niederlage der Revolution von 1848 geradezu einen »kuriosen« Aspekt. Doch bereits 1853 rückt er das Thema der cR aus dem Bereich kurioser Nachrichten heraus und zeigt den direkten Einfluß Europas auf die Ereignisse in China, wo die »chronischen Aufstände der letzten zehn Jahre [...] sich jetzt zu einer einzigen ungeheuren Revolution zusammengeballt haben« (Die Revolution in China und in Europa, MEW 9, 95f). Er betont das auslösende Moment des englischen Opiumhandels, durch den »die barbarische hermetische Abschließung von der zivilisierten Welt« (96) durchbrochen wurde und die »Autorität der Mandschu-Dynastie in Scherben [brach]« (ebd.). Zugleich erwartet er jedoch auch eine Rückwirkung der cR für die »Völker Europas«. Die Instabilität des chinesischen Marktes für britische Industriewaren und die Preissteigerungen für chinesischen Importtee würden bewirken, »daß die cR den Funken in das übervolle Pulverfaß des gegenwärtigen industriellen Systems schleudern und die seit langem heranreifende allgemeine Krise zum Ausdruck bringen wird, der dann beim Übergreifen auf das Ausland politische Revolutionen [...] unmittelbar folgen werden« (100). - Die Stärkung des chinesischen Nationalismus im Gefolge der Auseinandersetzungen mit England betont demgegenüber Engels in einem Beitrag von 1857, in dem er ironisch die englischen »Zivilisationskrämer« gegen die chinesischen »Barbaren« ausspielt. Er charakterisiert den Krieg in China als »Volkskrieg« einer aufständischen Nation und prophezeit eine Verschärfung der Krise (MEW 12, 214f).
1862, kurz vor der Niederlage des Taiping-Aufstandes, analysiert Marx die chinesische Situation ausführlicher. In seine Analyse geht seine vor allem durch die Beschäftigung mit Indien geprägte Konzeption der asiatischen Produktionsweise ein, nach der »rastloser Wechsel« des politischen Überbaus einhergeht mit »beständiger Bewegungslosigkeit im sozialen Unterbau« (MEW 15, 514). Den Trägern der cR, d.i. des Taiping-Aufstandes, wirft Marx vor, lediglich »die Zerstörung ohne irgendeinen Keim der Neubildung« anzustreben. Der fließende Übergang der Bewegung zum reinen Banditentum, ihre Beibehaltung der sozialen Grundlagen des Reiches, ihr »religiöser Anstrich« erweise sie daher als eine Bewegung »geräuschvoller Scheintätigkeit« und als »Absprung eines fossilen Gesellschaftslebens« (514ff). - In einem Brief an Kautsky aus dem Jahre 1895 wertet Engels dann den chinesisch-japanischen Krieg 1894/95 als das Ende des alten China, als »vollständige, wenn auch allmähliche Revolution der gesamten ökonomischen Grundlage [...] und damit die Massenauswanderung der chinesischen Coolies auch nach Europa, also für uns eine Beschleunigung des débacle und Steigerung der Kollision zur Krisis« (MEW 39, 301).
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die cR bei Marx und Engels vorrangig in ihrer Funktion für die Revolution in Europa in ihre Analysen einbezogen wird; die sozialen Ursachen und Auswirkungen für China bleiben dagegen sekundär.
2. Waren Marx' und Engels' Ausführungen zu China noch wesentlich von der Dichotomie Europa-Asien (vgl. MEW 9, 95: China als »direkter Gegenpol Europas«) beeinflußt, so geht Lenin in seinen Analysen von einer grundsätzlichen Vergleichbarkeit der russischen und chinesischen Entwicklung aus. Wie in Rußland litt auch das Volk in China unter einer »asiatischen Regierung« und »unter dem Joch des Kapitals« (LW 4, 375). In seiner Einschätzung des Sturzes der Mandschu-Dynastie 1911 stützt er sich weitgehend auf zwei Artikel von Pawlowitsch, die im theoretischen Organ der Sozialdemokratie erschienen. Der nationale und antidynastische Charakter der revolutionären Bewegung, ihr Charakter als »Klassenkampf«, als »Kampf gegen das alte halbfeudale System« werden hier bereits hervorgehoben (1911, 372, 375).
Wie Pawlowitsch spricht auch Lenin dem revolutionären Kampf des chinesischen Volkes weltweite Bedeutung zu für die Befreiung Asiens und die Untergrabung der Herrschaft der europäischen Bourgeoisie. Insgesamt ordnet er die Ereignisse von 1911 in den bürgerlichen Revolutionszyklus seit 1789 ein (LW 17, 477, 493). Zur näheren Bestimmung der Klassenverhältnisse nach der Revolution zieht Lenin einen Aufsatz des Führers der Revolution, Sun Yatsen (1912), hinzu. Ausgehend von »asiatischen« Gemeinsamkeiten aller »bürgerlichen Revolutionen Asiens« kennzeichnet er die bürgerlichen Demokratien dieser Länder, »die jetzt endgültig in den Strom der weltumfassenden kapitalistischen Zivilisation hineingezogen werden«, als »volkstümlerisch« gefärbt (LW 18, 153). Das Programm Sun Yatsens charakterisiert Lenin als Ausdruck einer noch fortschrittlichen Bourgeoisie in ihrem Kampf gegen feudale Verhältnisse. Es sei mit »sozialistischen Träumereien« von einer möglichen Vermeidung des Kapitalismus verquickt, verfechte jedoch objektiv ein »maximal kapitalistisches Agrarprogramm« (155f). Die sozialen Grundlagen der neuen chinesischen Republik beschreibt Lenin als »ein Bündnis der wohlhabenden Bauernschaft mit der Bourgeoisie [...], bei einem Fehlen oder bei völliger Ohnmacht des Proletariats« (393). Lenins wachsende Skepsis hinsichtlich der Realisierungsmöglichkeiten von Suns Programm äußert sich bereits im Mai 1913. Er konstatiert die Inkonsequenz einer nicht vom Proletariat geführten bürgerlichen Agrarbewegung, die zu einer »Allianz der europäischen Bourgeoisie mit den reaktionären Klassen und Schichten Chinas« tendiere (LW, EB 1, 282). Unter diesen Umständen sei die »demokratische Revolution« in China noch unvollendet, die breiten Volksmassen blieben ausgeschlossen und die Republik daher gefährdet. Im internationalen Maßstab erfülle die Bewegung Sun Yatsens jedoch eine fortschrittliche Funktion: »Das Erwachen Asiens und der Beginn des Kampfes des fortgeschrittenen Proletariats Europas um die Macht kennzeichnen die neue Ära der Weltgeschichte« (LW 19, 69, vgl. 82f). - In den folgenden Jahren wird die revolutionäre Bewegung in China von Lenin wiederholt angeführt, um summarisch auf die Bedeutung der Revolutionen Asiens hinzuweisen, die unter den Bedingungen des Imperialismus nationale Befreiungskriege darstellten und als »bürgerlich-fortschrittlich« einzustufen seien (LW 21, 305; vgl. 22, 318).
3. Auf dem II. Weltkongreß der K11920 wird die Frage der Einschätzung der cR in der Diskussion um die Kolonialfrage erneut aufgeworfen. Im Mittelpunkt steht das Problem, ob die KI »die bürgerlich-demokratische Bewegung in den zurückgebliebenen Ländern unterstützen« solle (Protokoll, 1921, 139). Im Ergebnis der Diskussionen wird der Begriff »bürgerlich-demokratisch« durch »nationalistisch-revolutionär« ersetzt, um auf diese Weise eine schärfere Abgrenzung zwischen reformistischer und revolutionärer Bewegung zu ermöglichen. Der zugeschriebene Klasseninhalt der Bewegung als einer bürgerlich-demokratischen wird davon nicht berührt. Die Bauernschaft wird als Vertreter der bürgerlich-kapitalistischen Verhältnisse gekennzeichnet und die Rolle der Bourgeoisie der unterdrückten Länder als »in gewissem Einvernehmen mit der imperialistischen Bourgeoisie« gegen die revolutionären Klassen charakterisiert (139f). Seitens der KI sollte eine Unterstützung der bürgerlichen Freiheitsbewegungen nur dann erfolgen, wenn die Bewegung wirklich revolutionär sei. In den »Ergänzungsthesen« des Inders M. N. Roy, die den Eurozentrismus der Arbeiterparteien kritisieren und die Kolonien als Dreh- und Angelpunkt revolutionärer Bewegung herausstellen, werden eine bürgerlich-nationalistische Bewegung, die die nationale Unabhängigkeit unter Bewahrung kapitalistischer Verhältnisse anstrebe, und eine Bewegung der Werktätigen, die sich auch gegen die eigenen besitzenden Klassen wende, unterschieden. Beide Bewegungen seien völlig unvereinbar. Roy hält zudem eine sozialistische Entwicklung in den Kolonien unter Umgehung des Kapitalismus für möglich (147ff).
Die auf dem II. Weltkongreß entwickelten Analysen werden von der 1921 gegründeten KPCh in ihre Programme aufgenommen. Ausgehend von diesen Analysen initiieren Komintern-Berater 1923 eine erste Einheitsfront von KPCh und Guomindang (GMD), die bis 1927 als Paradebeispiel und einzig erfolgreiches Modell der Zusammenarbeit zwischen einer KP und einer »wirklich revolutionären« bürgerlichen Partei dient. Ziel der Einheitsfront ist die politische Einigung des Landes und die Erlangung der nationalen Unabhängigkeit. Die GMD wird im Gemeinsamen Programm als führende Kraft dieser nationalrevolutionären Bewegung festgeschrieben. Reformen von oben und Revolution von unten, d.h. die Mobilisierung der Arbeiter und Bauern gegen die Feudalherren, sollen miteinander verbunden werden. Der in den Analysen des II. Weltkongresses der KI 1920 bereits angelegte Widerspruch, einerseits die Bauernschaft als Vertreter bürgerlich-kapitalistischer Verhältnisse einzustufen, andererseits aber von einem Widerstand bürgerlicher Parteien gegen eine revolutionäre Mobilisierung der Bauern auszugehen, sollte sich dann in der Praxis als unlösbar erweisen. Die Einheitsfront scheitert, große Teile der KPCh und der revolutionären Massenorganisationen werden von den Führern der GMD, die sich mit den imperialistischen Kräften verbündet haben, zerschlagen. In der Folge finden in der KI wie auch in der KPCh Debatten um Strategie und Taktik der cR und um eine neue Einschätzung des Charakters der chinesischen Gesellschaft statt.
Mit dem bevorstehenden Bruch der Einheitsfront gewinnt die chinesische Frage einen neuen Stellenwert im Fraktionskampf zwischen Stalin und der Vereinigten Opposition (Trotski, Sinowjew, Kamenew, Radek). Die von Trotski und Radek 1926 vertretenen Auffassungen erhalten neues Gewicht. Sie hatten die Existenz einer halbfeudalen Gesellschaftsstruktur und den bürgerlich-demokratischen Charakter der chinesischen Revolution in Frage gestellt und den sofortigen Übergang zur sozialistischen Revolution befürwortet. Bürgerliche und sozialistische Phase der Revolution seien miteinander verschmolzen, die Führung habe das Proletariat, die Bauern seien zur Führung der Revolution unfähig. Die Bourgeoisie, d.i. die GMD, sei selbst Objekt der Revolution. - Der Mehrheitsflügel der KI und die KPCh auf ihrem 6. Parteitag weisen die Auffassungen der Vereinigten Opposition zurück und bekräftigten den bürgerlich-demokratischen Charakter der cR. Sie sei antiimperialistisch und antifeudal, ihr Hauptinhalt bestehe zunächst in der Durchführung der Agrarrevolution. Doch neben den Feudalkräften wird nun auch die Bourgeoisie zu den Gegnern der Revolution gerechnet, während die Arbeiter und Bauern als ihre Träger gelten. Ziel ist zunächst die Errichtung der »demokratischen Diktatur der Arbeiter- und Bauernsowjets« unter Führung des Proletariats, bevor zu einer sozialistischen Revolution übergegangen werden könne. Diese Positionen stellen eine Absage an Ideen von einer besonderen Entwicklung in China dar, wie sie z.B. dem Konzept der asiatischen Produktionsweise zugeschrieben wurden. - Anfang der 30er Jahre begründet die KPCh erneut den halbkolonialen und halbfeudalen Charakter der chinesischen Gesellschaft, um die Notwendigkeit einer Fortsetzung der Revolution gegenüber GMD-Ideologen aufzuzeigen, die mit dem Erreichen der nationalen Einheit und Unabhängigkeit des Landes unter ihrer Führung im Jahre 1927 die cR als vollendet ansehen und dies aus einer besonderen Entwicklung Chinas ableiten.
Nach dem Scheitern der ersten Einheitsfront 1927 konstituieren sich kommunistische Truppenteile der ehemaligen Nationalarmee als Rote Armee neu. In den von ihr kontrollierten Gebieten in Mittelchina werden von 1931 bis 1934 sieben Sowjetgebiete aufgebaut, in denen radikale Reformen, u.a. die Enteignung von Großgrundbesitzern, durchgeführt wurden. Die Angriffe der Nationaltruppen der Guomindang-Regierung zwingen die kommunistischen Truppen 1934 zum Rückzug aus diesen Gebieten; die Rückzugsgefechte führen durch 11 Provinzen bis in die nordöstliche Gebirgsregion von Shaanxi, die die letzten Truppen im Dezember 1936 erreichten. In der Folge werden diese Absetzbewegungen, die nur ein Zehntel der ursprünglich aufgebrochenen Kämpfer überleben, als »Langer Marsch« zum Wendepunkt und Vorboten des künftigen Sieges erklärt.
4. Angesichts der nationalen Bedrohung durch den japanischen Imperialismus seit 1931 und der wachsenden weltweiten Faschismusgefahr bestimmt die KI seit 1935 und in der Folge auch die KPCh den Charakter, die Strategie und die Aufgaben der cR neu. Der nationale antifaschistische Widerstandskrieg gegen die japanische Invasion wird zur Hauptaufgabe erklärt. Dementsprechend soll der Kampf gegen die GMD zugunsten einer neuen Einheitsfront aufgegeben werden. Der GMD als Partei der Bourgeoisie werden mit der KPCh gemeinsame antiimperialistische Interessen zugesprochen. Im Dezember 1938 anerkennt die KPCh die Führungsrolle der GMD in der Einheitsfront und spricht sich für eine Unterstützung der Nationalregierung sowie der nationalen Streitkräfte durch die Rote Armee aus. Diesem Beschluß sind Auseinandersetzungen in der KPCh um die Frage der Führung der Revolution und des Widerstandskrieges und um eine unabhängige Politik der KPCh in der Einheitsfront vorausgegangen; die Debatten darüber bestimmen die innerparteilichen Kontroversen der folgenden Jahre. Im Mittelpunkt stehen Fragen der Anwendung des Marxismus in China, der Zurückstellung sozialer Ziele (Agrarrevolution) zugunsten nationaler Ziele und der militärischen Strategie: Guerillakampf zum Schutz der Befreiten Gebiete oder reguläre Kriegsführung gegen Japan mit den Truppen der Nationalarmee.
Chen Shaoyu (Wang Ming) und Mao Zedong sind die Protagonisten unterschiedlicher Konzeptionen der cR, wobei Mao seine Positionen weitgehend durchsetzt und sie im April 1945 vom 7. Parteitag der KPCh bestätigen läßt. Chen gibt der Einheitsfront als Instrument des Widerstandskrieges – langfristig auch als Instrument sozialer und demokratischer Reformen – Priorität. Die Bourgeoisie und das Proletariat der Städte sollen Träger der sozialen Veränderungen sein. Chens Strategie liegt die Annahme von der Übereinstimmung des Kampfes um nationale Selbstbestimmung und für eine antifeudale Revolution zugrunde. Demgegenüber geht Mao von einer Gleichwertigkeit des nationalen und des sozialen Kampfes aus. Er sieht die Einheitsfront vor allem unter taktischem Aspekt und will durch die Fortsetzung der sozialen Veränderungen die Position der KPCh ausbauen. Die Bauern sind für Mao Hauptträger der Bewegung, und die Autonomie der KPCh und der Befreiten Gebiete haben Priorität. In seinen Aufsätzen Die chinesische Revolution und die Kommunistische Partei Chinas und Über die Neue Demokratie von Ende 1939 wird die Lösung der nationalen Frage auf den zweiten Platz verwiesen und werden die revolutionären Zielvorstellungen neu formuliert (AW 2, 353ff, 395ff). Mao charakterisiert die cR als eine »neudemokratische Revolution bzw. Revolution der ‘Neuen Drei Volksprinzipien’«, als eine »antiimperialistische und antifeudale Revolution der Volksmassen unter Führung des Proletariats«. Ihre Staatsform soll eine »Diktatur der Einheitsfront aller revolutionären Klassen unter Führung des Proletariats« sein (380). Die führende Rolle in der neudemokratischen Revolution spricht er der KPCh zu. Das Programm weist über die Periode der Einheitsfront hinaus; es wird bis Anfang der 50er Jahre Grundlage der Politik bleiben: zunächst in den Befreiten Gebieten, dann, mit den Siegen im Bürgerkrieg 1945-1949 und der Gründung der Volksrepublik China 1949, im ganzen Land.
5. In der Aufarbeitung der kulturrevolutionären Periode (1966-1976) wird die Frage der gesellschaftlichen Stellung der Intellektuellen in der VR China erneut thematisiert. Diese Diskussionen implizieren eine Bewertung des historischen Charakters der cR; insbesondere wird die Frage aufgegriffen, ob es sich bei den Entwicklungen bis 1949 lediglich um eine Bauernrevolution gehandelt habe. Eine öffentliche Debatte darüber findet jedoch nicht statt. In den 60er und 70er Jahren greifen Theoretiker der Neuen Linken außerhalb Chinas (u.a. Betteheim und Masi) auf Theorien über den Charakter der cR zurück und diskutieren Einschätzungen der cR als Bauernrevolution, bürgerlich-demokratische oder proletarische Revolution und das Konzept einer Fortführung des revolutionären Prozesses auch in der VR China im Sinne der Theorien einer »permanenten Revolution«. Diese Diskussionen entstehen aus dem Interesse an der Herstellung einer Kontinuität des weltrevolutionären Prozesses in den Metropolen und in der »Dritten Welt«.
Bibliographie: H.C. D´Encausse u. St.R. Schram (Hg.), Marxism and Asia. An Introduction with Readings, London 1969; J.P. Harrison, Der lange Marsch zur Macht. Die Geschicke der Kommunistischen Partei Chinas von ihrer Gründung bis zum Tode von Mao Tse-tung, Stuttgart-Zürich 1978; G. Kleinknecht, Die kommunistische Taktik in China, 1921-1927. Die Komintern, die koloniale Frage und die Politik der KPCh, Köln-Wien 1980; D. Lowe, The Function of »China« in Marx, Lenin and Mao, Berkeley-Los Angeles 1966; M.P. Pawlowitsch, »Die große chinesische Revolution«, in: NZ, 1911, Nr. 30/1; Sun Yatsen, »Demokratie und Volkstümlerideologie in China«, in: Le Peuple, 11.7.1912; K.A.Wittfogel, »The Marxist View of China. Part I and II«, in: The China Quarterly, 1962, H. 11, 1ff, H. 12, 154ff; U. Wolter (Hg.), Die Linke Opposition in der Sowjetunion, Berlin/W 1977; II. Kongreß der KI. Protokoll der Verhandlungen vom 19. Juli in Petrograd und vom 23. Juli bis 7. August 1920 in Moskau, Hamburg 1921.
Mechthild Leutner
→ asiatische Produktionsweise, Aufklärung, Bauern, Bauernbewegung, chinesische Kulturrevolution, Drei-Welten-Theorie, Einheitsfront, Imperialismus, Internationale, Mao-Zedong-Ideen, permanente Revolution, politische Ökonomie, Revolution, Revolutionstheorie