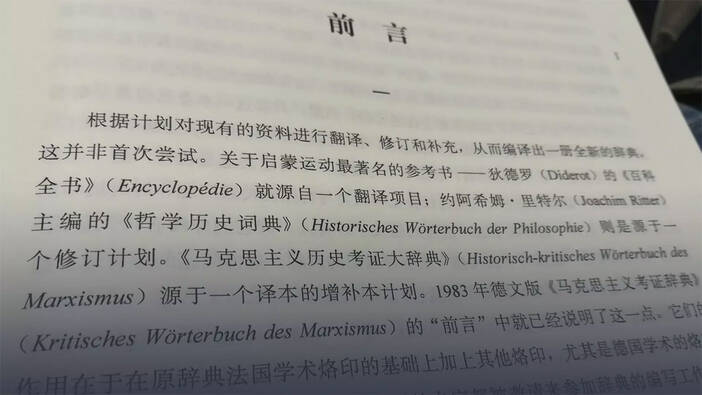Das Historisch-kritische Wörterbuch des Marxismus (HKWM) ist ein marxistisches Lexikon, das nach seiner Fertigstellung 15 Bände und über 1.500 Einträge umfassen wird. Von den bisher erschienenen neun Bänden in deutscher Sprache sind seit 2017 zwei Bände in chinesischer Sprache herausgegeben worden. Im Frühjahr 2019 hat die Rosa-Luxemburg-Stiftung gemeinsam mit dem HKWM-Team die «Internationalisierung» des Lexikons auf Englisch und Spanisch vorangetrieben, um eine neue Generation marxistischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der ganzen Welt für das Projekt zu gewinnen und seine Leserschaft und Reichweite zu vergrößern. Der unten stehende Eintrag ist Teil einer Auswahl dieser Übersetzungen, die auf unserer Website zur Verfügung gestellt werden.
Weitere Informationen über das Projekt und andere übersetzte Lexikon-Einträge finden sich in unserem HKWM-Dossier.
A: naẓarīyat al-cawālim al-thalātha. – E: three worlds theory. – F: theorie des trois mondes. – R: teorija trech mir. – S: teoría de los tres mundos. – C: san’ge shijie huafen de lilun 三个世界划分的理论
Die DWT stützt sich auf eine Bemerkung Maos vom 22. Februar 1974 (im Gespräch mit dem sambischen Präsidenten K. Kaunda): »Meiner Meinung nach bilden die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion die Erste Welt. Japan, Europa und Kanada, die Kräfte der Mitte, gehören zur Zweiten Welt. Wir sind die Dritte Welt. [...] Die Dritte Welt hat eine große Bevölkerung. Mit Ausnahme Japans gehört Asien zur Dritten Welt, und Lateinamerika ebenfalls.« Diese Äußerung wurde erst am 1.11.1977 im Zentralorgan des ZK der KPCh Renmin Ribao veröffentlicht, doch zeigten sich Auswirkungen auf die chinesische Außenpolitik bereits in der Rede von Deng Xiaoping vor der UNO-Vollversammlung am 10.4.1974. Deng zitierte Maos Äußerung, ohne ihren Urheber zu nennen. Danach betonte er den politischen Kern der DWT: »Die beiden Supermächte, die USA und die Sowjetunion, trachten nach einer Vorherrschaft über den Erdball. Sie versuchen, jede auf ihre Weise, die Entwicklungsländer Asiens, Afrikas und Lateinamerikas unter ihre Kontrolle zu bringen, und zugleich die entwickelten Länder, die ihnen machtmäßig nicht gewachsen sind, zu tyrannisieren.«
Chinas Bruch mit der Sowjetunion – eine der Vorbedingungen für die Formulierung der DWT –‚ der Ende der 1950er Jahre begann und Mitte der 60er Jahre mit dem Abschluß der Polemik über die Generallinie der internationalen kommunistischen Bewegung (1963 /64) endgültig vollzogen wurde, hat historische Wurzeln, die sich bis in die 1930er Jahre verfolgen lassen. In der KPCh gab es schon früh Widerstände gegen die Komintern- und KPdSU-Politik, sofern sie die chinesische Revolution betraf. Unter Maos Führung verfolgte die KPCh einen eigenständigen Kurs, besonders hinsichtlich der Frage nach der Hauptkraft der Revolution (Bauern statt Industrieproletariat) und der Bündnispolitik gegenüber der Guomindang. Aus der traditionellen sinozentrischen Denkweise (»Reich der Mitte«) und dem Selbstbewußtsein, das einer aus eigener Kraft und z.T. gegen sowjetische Anweisungen siegreichen Revolution entsprang, ergab sich zwangsläufig eine Sonderrolle Chinas im »sozialistischen Lager«, die einer Unterordnung unter sowjetische Führung entgegenstand. Die Machtpolitik der UdSSR nach 1949, vor allem die Versuche, China in das eigene militärpolitische Konzept zu integrieren (etwa mit dem Wunsch nach Errichtung sowjetischer Marinebasen auf chinesischem Territorium) verstärkten die Tendenzen, sich schrittweise von der SU zu distanzieren. Zudem sah sich China zunächst als »armes« und unterentwickeltes Land, das sich weder mit den entwickelten kapitalistischen noch mit den entwickelten sozialistischen Staaten (Atomwaffen und Raumfahrt in der SU) messen konnte. So verstärkte China seit 1955 (Bandung-Konferenz) sein außenpolitisches Engagement im Bereich der »Blockfreien«, vor allem des Trikont.
Der Bruch mit der SU und die damit verbundene Spaltung des »sozialistischen Lagers« brachte China in eine schwierige Situation. Die chinesische Führung kam zu dem Schluß, daß China von sowjetischer Seite eine größere Gefahr drohe als vom US-Imperialismus; gleichzeitig maß sie den innerimperialistischen Widersprüchen große Bedeutung zu. Sie mußte sich neue Verbündete suchen. In der Reihenfolge der Gewichtung waren das: 1. sozialistische Staaten, die China freundlich gesinnt waren (Albanien, Nordkorea, eingeschränkt Nordvietnam und Rumänien); 2. die »Dritte Welt«; 3. Staaten der »Zweiten Welt«, die sich dem Einfluß der Supermächte zu entziehen versuchten; 4. die USA als »weniger gefährliche Supermacht«. Somit kann die Formulierung der DWT letztlich als Endpunkt einer außenpolitischen Umorientierung gesehen werden.
Nachträglich wurde die DWT mit »Klassiker-Zitaten« – im Kontext des chinesischen ML vor allem Lenin, Stalin und Mao – begründet. In Die Theorie des Vorsitzenden Mao (1977) belegte man die Korrektheit der Strategie eines Bündnisses mit der »Dritten Welt« u.a. mit einer Einschätzung Lenins aus dem Jahre 1916: »Die soziale Revolution kann nicht anders vor sich gehen als in Gestalt einer Epoche, in der der Bürgerkrieg des Proletariats gegen die Bourgeoisie in den fortgeschrittenen Ländern mit einer ganzen Reihe demokratischer und revolutionärer Bewegungen verbunden ist, darunter auch mit nationalen Befreiungsbewegungen der unentwickelten, rückständigen und unterdrückten Nationen.« (LW 23, 53). Auch die Aufteilung in mehrere »Welten« wurde in Leninsche Tradition gestellt: »Das charakteristische Merkmal des Imperialismus besteht darin, daß sich, wie wir sehen, gegenwärtig die ganze Welt in eine große Zahl unterdrückter Völker und eine verschwindende Zahl unterdrückender Völker teilt.« (LW 31, 228) »Leider gibt es jedoch heute auf der Welt zwei Welten: die alte – den Kapitalismus [...] und die heranwachsende neue Welt.« (LW 33, 132) Stalin: »Die Welt hat sich entschieden und unwiderruflich in zwei Lager gespalten: in das Lager des Imperialismus und in das Lager des Sozialismus.« (W 4, 205) – Damit war zunächst nur die Zweiteilung der Welt erklärt. Aber Stalin traf auch schon die zweite Teilung, die quer zur ersten verstanden werden konnte: »Die Welt ist in zwei Lager geteilt: in das Lager einer Handvoll zivilisierter Nationen, die über das Finanzkapital verfügen und die die gewaltige Mehrheit der Bevölkerung des Erdballs ausbeuten, und in das Lager der unterdrückten und ausgebeuteten Völker der Kolonien und der abhängigen Länder, die diese Mehrheit bilden.« (W 6, 127)
Als Praktiker und Theoretiker eines solchen Landes zog Mao daraus 1940 den Schluß: »Diese [Welt-]Revolution hat das Proletariat der kapitalistischen Länder zur Hauptkraft und die unterdrückten Nationen der Kolonien und Halbkolonien zu ihren Verbündeten. Unabhängig davon, welche Klassen, Parteien oder Einzelpersonen einer unterdrückten Nation an der Revolution teilnehmen – diese Revolution wird, wenn sie alle nur gegen den Imperialismus kämpfen, zu einem Bestandteil der proletarisch-sozialistischen Weltrevolution, und ihre Teilnehmer werden zu deren Bundesgenossen, ob sie sich nun dieses Umstands bewußt sind oder nicht, ob sie ihn begreifen oder nicht.« (AW II, 404). Diese Äußerung wurde später, als die DWT die Außenpolitik der VR China bestimmte, als Begründung dafür herangezogen, daß die Klassengegensätze in den Ländern der »Dritten Welt« gegenüber dem Antagonismus zwischen diesen Ländern und den »Supermächten« vernachlässigt werden könnten. Die endgültige Abkehr von der Zweiteilung der Welt, wie sie Lenin und Stalin vorgenommen hatten, vollzog Mao im Januar 1957: »Selbstverständlich sind die Widersprüche zwischen den imperialistischen und den sozialistischen Ländern sehr scharf, aber jetzt ringen die imperialistischen Staaten miteinander um verschiedene Gebiete, und der Kampf gegen den Kommunismus dient ihnen nur als Vorwand. Um welche Gebiete ringen sie? Um die Territorien Asiens und Afrikas mit ihrer Milliarde Bewohner. [...] Dort sind zwei Arten von Widersprüchen und drei Arten von Kräften in Konflikt geraten. Die zwei Arten von Widersprüchen sind: erstens die Widersprüche zwischen den verschiedenen imperialistischen Mächten, das heißt zwischen den USA und England sowie zwischen den USA und Frankreich; zweitens die Widersprüche zwischen den imperialistischen Mächten und den unterdrückten Nationen. Die drei Arten von Kräften sind: erstens die USA, die größte imperialistische Macht; zweitens England und Frankreich, imperialistische Mächte zweiten Ranges; und drittens die unterdrückten Nationen.« (AW V, 408f) Damit waren im Prinzip schon die späteren »drei Welten« der DWT benannt, nur die SU mußte noch der Kategorie der Supermächte zugeordnet werden.
Die KPdSU kritisierte diese »neue Theorie«, »derzufolge der Grundwiderspruch unserer Zeit nicht der Widerspruch zwischen Sozialismus und Imperialismus, sondern der zwischen der nationalen Befreiungsbewegung und dem Imperialismus sei« (Die Polemik, 1965, 225), und die KPCh verurteilte wiederum die KPdSU, die die genannten Positionen Lenins und Stalins hinsichtlich der nationalen Befreiungsbewegungen aufgegeben habe (221-27). Mao selbst hat allerdings durch keine bekannte schriftliche oder mündliche Äußerung eine »DWT« befürwortet, im Gegenteil, er hat offenbar sogar Zeit seines Lebens verhindert, daß seine Äußerung vom 22.2.1974 veröffentlicht wurde. Die Formulierung der DWT als »bedeutender Beitrag zum Marxismus-Leninismus« fand erst 1977, ein Jahr nach seinem Tode statt. Hingegen hat er sie im Sinne eines außenpolitischen Konzepts entwickelt und mitgetragen.
Charles Bettelheim bestritt 1978 (129, Anm. 70) der DWT jede wissenschaftliche Basis und jede Entsprechung in der Wirklichkeit. »It wrongly assumes that, as between the ‘Second’ and the ‘Third’ worlds, unity can have primacy over contradiction, an idea which runs counter to everything taught us by history, past and present. History reveals the deep conflicts which set many of the countries of the ‘Second’ and the ‘Third’ worlds against each other«. Die DWT »buries the class contradictions involved«, erst recht die zwischenstaatlichen Antagonismen.
De facto blieb die DWT nach Maos Tod ein taktisches außenpolitisches Konzept und wurde nicht zu einer Theorie, die auf einer konkreten Analyse beruht hätte. Sie ging von bestimmten, kaum begründeten theoretischen Vorgaben aus, z.B. daß die SU »sozialimperialistisch«, »sozialfaschistisch« und »staatskapitalistisch« sei. Nachdem zu Beginn der 1980er Jahre diese Vorgaben und schließlich sogar der Revisionismus-Vorwurf gegen die KPdSU fallengelassen wurden, verschwand auch die DWT. Insofern kann sie nicht als strategisches Konzept begriffen werden, da sie in ihrer Gesamtheit von der jeweils aktuellen taktischen Einschätzung der SU abhängig war. Zwei andere Grundelemente der DWT hingegen, die Orientierung auf die »Dritte Welt« und ihre nationalen Befreiungsbewegungen sowie der Widerstand gegen imperialistischen »Hegemonismus« usw., blieben für die chinesische Außenpolitik relevant.
Etwa mit Beginn der 1990er Jahre, als die Reformpolitik der »sozialistischen Marktwirtschaft« zu einem stürmischen wirtschaftlichen Aufschwung führte, während die SU sich auflöste, wurde auch dies obsolet. Chinas Außenpolitik orientierte sich um auf die Industrie-Nationen, und seine nationalen Interessen – vor allem die ökonomischen – gerieten immer öfter in Gegensatz zu den Interessen anderer Staaten des Trikont.
Bibliographie: C. Bettelheim, »The Great Leap Back-ward«, in: Monthly Review, 30. Jg., H. 3, 1978; »Die Theorie des Vorsitzenden Mao über die Dreiteilung der Welt ist ein bedeutender Beitrag zum Marxismus-Leninismus«, von der Redaktion der Renmin Ribao, I. November 1977, in: Peking-Rundschau, Nr. 45/ 1977, 11-43; Die Theorie der Drei Welten, 2 Bde., hgg. v. ZK der Marxisten-Leninisten Deutschlands, Frankfurt/M 1978 (Dokumente I: Die Theorie der Drei Welten. Die Klassenlinie im Internationalen Kampf des Proletariats. Dokumente der KPCh und der Partei der Arbeit Albaniens; Dokumente II: Der Vormarsch der Drei-Welten-Theorie Mao Tsetungs); Deng Xiaoping, »Rede auf der Sondertagung der UNO-Vollversammlung (10. April 1974)«, in: Peking-Rundschau, Nr. 15/1974, 8-13; Die Polemik über die Generallinie der internationalen kommunistischen Bewegung, Peking 1965.
Ingo Nentwig
→ Blockfreiheit, chinesische Kulturrevolution, chinesische Revolution, Dritte Welt, Hegemonismus, Maoismus, Mao-Zedong-Ideen, sozialistische Marktwirtschaft, Supermächte, Trikontinent