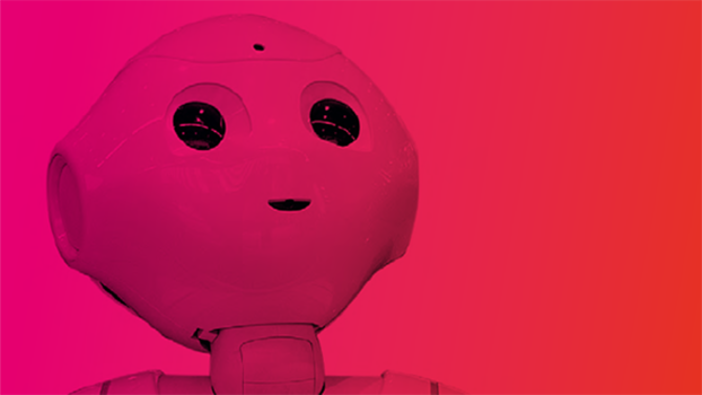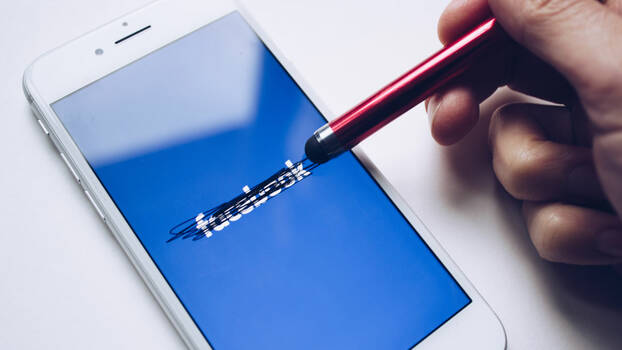
- «This is in the end what Silicon Valley tries to prevent at all cost: mass resistance and mass exodus.» (Geert Lovink)
- «Die fast unlösbare Aufgabe besteht darin, weder von der Macht der anderen, noch von der eigenen Ohnmacht sich dumm machen zu lassen.» (Theodor W. Adorno)
Die Aufregung ist wieder groß – zu recht. Cambridge Analytica und Facebook bildeten, darauf deuten zumindest alle Zeichen hin, in so manchen Wahlkämpfen unserer Zeit eine mediale Mesalliance – für den Nutzer. An dieser Stelle soll weniger über die letzten Details des 50-Millionen NutzerInnen-Datenlecks (zuletzt korrigierte der CTO Facebooks die Zahl auf 87 Millionen) berichtet oder gefragt werden, ob es überhaupt ein Leck oder nicht doch viel eher – ja! – die Alltagspraxis des Überwachungskapitalismus selbst ist, die uns hier offenbar wird. Vielmehr interessiert die Dynamik der Enthüllungen und ihre diskursiven Schlussfolgerungen, denn bereits an ihnen wird flagrant, zur welcher Debatten- und (De-)mobilisierungskultur uns die Architekturen der Plattformen erzogen haben – und welche ‹Lösungen› uns die ihnen zu Grunde liegende kybernetische, d.h. feedbacklogische Infrastruktur nahelegt.
Zunächst ein kurzer Rückblick: Ende 2016 waberte in Folge des Artikels «Ich habe nur gezeigt, dass es die Bombe gibt» von Hannes Grassegger und Mikael Krogerus eine Welle der Diskursverknappung eruptiv durch das Internet. Anstatt die Reportage über den digitalen Wahlkampf in den USA und die fragwürdigen Machenschaften von CA zum Anlass zu nehmen, eine gesellschaftliche Debatte über personalisiertes Targeting oder den hintergründigen Datenhandel der Tech-Konzerne zu adressieren, wurde der Artikel nach anfänglich aufgeregtem Sharen und Liken – gemäß der bipolaren Klickkultur sozialer Netzwerke – von einem relativierenden Stimmenkonsortium eingeebnet. Wer sich für den Artikel interessierte, dem wurde schnell erklärt, dass es sich bei der investigativen – freilich provokativ zugespitzten – Geschichte bloß um eine packende Erzählung monokausaler Sinnstiftung, eine «linke Verschwörungstheorie» handele, dass die Akteure CAs bloß «Luftpumpen» seien, die für sich Marketing machten; dass ihre Methoden (Targeting, Psychometrics etc.) entweder wirkungslos, gang und gäbe, Scharlatanerie waren – oder gar nicht eingesetzt wurden. Eine größere Diskussion jenseits der beklemmenden Box aus Für- und Wider blieb in den Netzwerken aus, alles Weitere verschwand weitestgehend im Rauschen der Rückkopplungen – zumindest hierzulande.
Im englischsprachigen Raum entfaltete die Übersetzung des Artikels zunächst eine ähnlich rudimentäre Wirkung. Immerhin folgte eine das Jahr 2017 füllende Investigativrecherche der Journalistin Carole Cadwalladr über das fragwürdige Netzwerk (von Steve Bannon bis Robert Mercer) hinter CA, die dazu führte, dass die britischen Behörden den Fall juristisch prüften. Trotz dieser intensiven Vorarbeiten, die im englischen Sprachraum – der Brexit und ein beständig twitternder Präsident schufen hier eine persistentere Form der Aufmerksamkeit – immer wieder gesellschaftliche Diskussionen provozierten, fühlte man sich bei der aktuellen Debatte um die Enthüllungen des Whistleblowers Christopher Wylie (auch hier war Cadwalladr federführend) in einer Wiederholungsschleife gefangen. In den sozialen Netzwerken zeichneten sich schnell – wenngleich etwas weniger deutlich – zwei Lager ab: Wieder empörte man sich, wieder relativierte man, und so schienen die Einen den Anderen nicht nur von den Magiern aus «Hogwarts Analytica» verzaubert, auch die Kontroverse selbst drohte sich erneut auf die (Un-)Wirksamkeit feingezielter Werbung zu verkürzen: Wo Differenziertheit gefragt war, saß man scheinbar abermals der polarisierenden Architektur der sozialen Netzwerke auf, indem man ihre Logik implizit reproduzierte – und wie digitale Binärcodes in ja oder nein – 0 oder 1 unterschied.
Doch mit etwas Verzögerung – und hier reflektiert sich sowohl Cadwalladrs beharrliche Berichterstattung als auch das personell aufgeladene, faktenlastige und diesmal audiovisuell aufbereitete Material – liess sich dann eine wünschenswerte Sensibilisierung ausmachen, sodass man fortan weniger über die vermeintlichen Fähigkeiten CAs spekulierte, als vielmehr über Grundlegenderes diskutierte. In vielen Kommentaren zeichnete sich ab, dass vor allem die Geschäftspraktiken Facebooks und die überwachungskapitalistische Infrastruktur der Plattform, d.h. die prekären Hintergründe kritischer zu betrachten wären. Man fokussierte in diesem Rahmen die Probleme des Datenhandels, der Datensouveränität und Datendemokratie, doch die dringlichen Analysen ließen alsbald eine praktische Unentschlossenheit um die Frage entstehen: Was tun?
Aus ihr erwuchs der Hashtag #deletefacebook – und damit eine Bewegung, die nach dem Skandal-Trommelfeuer Facebooks – von Hate-Speech über Fake-News und Dark-Ads bis zur aktuellen Debatte um den undurchsichtigen Datenhandel – endlich Schluss machen wollte mit der Plattform; eine Bewegung aber auch, die erneut eine Polarisierungswelle und den altbekannten Mechanismus, das diskussionsarme Entweder-Oder der Netzgemeinde, nach sich zog: Während die einen also die Chance witterten, den wankenden Monopolisten umzustürzen, ihm eine Lektion erteilen und sich ganz nebenbei von einem bloßen «Zeitfresser» befreien wollten, folgte alsbald die Gegenrede mit relativierenden Antworten, die Jaron Lanier als kurzsichtig, teilweise ignorant beschrieb. In Facebook erkannte man – und hier reproduzieren sich die Werbeversprechen Zuckerbergs – eine «globale Community», einen «Weltzugang», ein «praktisches Adressbuch» und einen Ort, an dem man mit «Menschen in Kontakt […] bleiben» kann. Melde man sich ab, sei dies eine «Kapitulationserklärung», «ultimately self-defeating» oder «persönlicher Boykott». Das privatwirtschaftliche Unternehmen sei «schlicht zu relevant» und im Verbund mit den von ihm aufgekauften Instagram und Whatsapp zu einer «sozialen Infrastruktur» wie das öffentliche Straßensystem geworden; eine soziale Infrastruktur – auch Zuckerberg verwandte diesen Begriff in seinem «Manifest» vom Februar 2017 ganze 24-mal –, auf deren Netzwerkeffekte man sowohl aus persönlichen als auch aus beruflichen Kontaktgründen nicht verzichten dürfe. Das Abmelden von Facebook sei ein «Privileg» geworden, das man sich – wie Tesla-Chef Elon Musk oder Whatsapp-Gründer Brian Acton medienwirksam vormachten – leisten können muss. Und wer es trotzdem tut, so ließen resignative EinsichtsträgerInnen wissen, über den lege der Konzern sowieso Schattenprofile an, auch wenn man sich ‹nur› zum realen Freundeskreis der Mitglieder zähle. Die Quintessenz der #deletefacebook-Gegnerschaft lautete also: Man könne besser gleich sein Mobiltelefon «vergraben» oder ins Exil gehen – und so blieb einzig die Hoffnung, dass der Konzern durch die fallenden Aktienkurse endlich «gewarnt» sei.
Vor diesem Hintergrund zeigt die Debatte um #deletefacebook nicht nur auf, dass die Plattform, gerade angesichts der berechtigten Kritik, noch immer viele FürsprecherInnen hat, die sich keine Welt mehr ohne das erst knapp fast 14 Jahre alte Unternehmen vorstellen mögen, sie weist noch auf eine tiefer liegende Problematik hin: die Tatsache nämlich, dass die derzeitige Technosphäre, und insbesondere der Monopolist Facebook selbst einigen KritikerInnen alternativlos erscheint.
Die Konsequenz daraus reflektierte sich im Anschluss vor allem – und dies kann wieder als Einebnung der Debatte um #deletefacebook gelesen werden – in einem passiv-aggressiven Pragmatismus: So käme es, da man Facebook ja nicht verlassen könne, auf die «Reparatur», die Selbstregulierung – mit Mark Zuckerberg gesprochen das «fixing» – des Netzwerks an. Zunächst sollten die selbstlernenden Kräfte der Plattform mobilisiert werden oder UserInnen des sozialen Netzwerks auf eben dieses Druck ausüben, sich laut zu Wort melden, sodass sich das System von innen heraus oder – systemtheoretisch gesprochen – autopoietisch transformiert, verbessert. Im Magazin WIRED schrieb Matt Reynolds folglich: «Rather than rushing to delete Facebook, perhaps we should start by really getting a handle on what Facebook is, the good bits and the bad bits, and put pressure on the platform to reform its ways once and for all.» Auf Quartz ergänzten die Online-Protestforscherin Sandra Gozáles-Bailón und die Doktorandin Ashley E. Gorham: «Instead of using social media to facilitate solipsistic solutions like opting out of the service, people who care about privacy should use the tremendous coordinating power of Facebook to facilitate real change.» Zu guter Letzt folgte, einerseits auf die Selbstheilungskräfte der Plattform, andererseits auf Justitia vertrauend – ein neues Hashtag: «Instead of #deletefacebook, let us go for #regulatefacebook.»
So systemtheoretisch geschmeidig die erste Strömung des #regulatefacebook – die Befürwortung der Selbstregulierung – klingt, so wenig erfolgsversprechend war sie in der Vergangenheit. In dieser Hinsicht verkennt das charmante Argument, dass es Zuckerberg bisher – trotz aller #fixingfacebook-Ambitionen oder dem #timewellspent-Ideal, stets vermied, wirklich Grundlegendes zu ändern – ganz im Gegenteil. Zumeist wurden nach eindrücklichen, fast agitatorischen Statements aus der Konzernzentrale einige neue Transparenzregeln erlassen – wie im Skandal um die Dark-Posts folgten sie auch im aktuellen Fall wenige Tage später –, die nicht nur die aufgeregten NutzerInnen wie AnlegerInnen besänftigen, sondern in einer Art vorauseilendem Gehorsam vor allem Intervention von außen umgehen sollten. Zwar deutete «Zuck» zuletzt zögerlich an, dass er sich auch eine externe Regulierung vorstellen könne, doch machte er kurz darauf klar, dass man nicht vom Kerngeschäft abrücken, Facebook weiterhin eine offene Shoppingmall für Targeting bleiben wird: «If you want to build a service that helps connect everyone in the world, then there are a lot of people who can’t afford to pay. (…) Having an advertising-supported model is the only rational model that can support building this service to reach people.» So wirken Zuckerbergs geständiges MeaCulpa («Wir haben die Verantwortung, eure Informationen zu schützen. Wenn wir das nicht können, verdienen wir sie nicht») und die anheimelnden Verbesserungsambitionen («I promise to do better for you») wie bittere Beruhigungspillen – oder rhetorische Weichspüler, die vor allem darauf zielen, dass sich in der aufmerksamkeitsökonomisch zugerichteten Öffentlichkeit, doch – bitte – alsbald der Fokus verschieben möge.
Obgleich das Drängen auf externe Regulierungen – die zentrale Forderung einer zweiten Position des #regulatefacebook – durchaus hilfreich seien könnte (erste, progressive Ansätze in diesem Bereich finden sich sowohl in der europäischen Datenschutzverordnung als auch den Regelungen zur E-Privacy), werden sie – zumindest in der bisherigen Form – nichts an dem Geschäftsmodell des Datenextraktivismus ändern. In den USA soll zwar die Gesetzesinitiative Honest Ads, wie im Fernsehen und Radio üblich, verhindern, dass auch auf Plattformen wie Facebook keine Falschmeldungen zirkulieren und die Absender transparenter werden. Wirklich erhellend wäre eine Regulierung aber nur dann, wenn, wie Frank Rieger, Sprecher des CCC, zuletzt forderte, ein Gesetz erlassen werden würde, «das Facebook & Co. zwingt, in Echtzeit offenzulegen, wer wieviel für welche Inhalte bezahlt und nach welchen Kriterien genau personalisiert und gezielt ausgeliefert wird.» Ein solches Gesetz zielte genau auf die Praktiken der Plattform ab, doch so viel – revolutionären – Eifer konnte die Debatte um #regulatefacebook bisher kaum erzeugen. Aller Voraussicht nach also bleibt Zuckerberg – trotz allem – «Monopolist des Lichts».
In den Wellen der Debatte um das to be, or not to be on facebook wurde also vor allem eines deutlich: dass mit der ‹vernünftigen› Lösung, dem #regulatefacebook auch unweigerlich das Eingeständnis der Systemrelevanz dieser Plattform einhergeht. Denn sofern #deletefacebook keine empfehlenswerte Option darstellt, weil wir uns mit dem Austritt ins soziale Abseits manövrieren, scheint die Konsequenz zu lauten, dass es kein Außen mehr gibt; dass es Facebook by design und Clicktivism geschafft hat, der Gesellschaft eine reduzierte Form des Sozialen, die Simulation einer «globalen Community», zu imprägnieren – sodass man also stillschweigend, trotz lauter Empörung und dem hoffnungsvollen Faktor der Regulierung, längst die Schlüssel übergeben hat. Wenn Facebook darüber hinaus noch zur ‹Plattform› des Widerstands – gegen sich selbst – erklärt wird, weil sich hinter der überwachungskapitalistischen Fassade auch eine mobilisierende – die «gute» – Kraft verberge, offenbart sich sukzessive ein ideenloses Denken, das nicht nur den Bock zum Gärtner macht, sondern wie jede doppelt aufgeführte Tragödie zur Farce gerät.
Letztlich übt man sich so in einem digitalen Stockholmsyndrom, einer Form der zirkulierenden, zynischen Vernunft: Wir wissen was wir tun, und tun es trotzdem – weil es unsere ‹Freunde› tun, die es auch nur tun, weil wir es tun. In diesem Lichte ist das Argument, dass ein #deletefacebook mit hohen persönlichen Kosten verbunden ist, von einer Verteidigung des Status Quo kaum mehr zu unterscheiden. Es verkennt vor allem, dass es jenseits der «way too idealistic» (Sheryl Sandberg, COO von Facebook) Plattform Alternativen gibt, die im Rausch(en) der Likes, den Netzwerkeffekten und der Marktmacht des Monopolisten weitestgehend untergegangen sind.
Die Anzahl an Personen, die soziale Netzwerke jenseits von Facebook & Co. nutzen, die die Privatsphäre schützen und der Filterblasenlogik entgegenwirken – unter ihnen das dezentral aufgebaute, komplett werbefreie diaspora – ist zwar, im Vergleich zu den 2,2 Milliarden Nutzern Facebooks verschwindend gering. Doch es gibt sie. Freilich besteht das Problem darin, dass die kritische Masse an UserInnen – ähnlich wie bei den WhatsApp-Alternativen Threema und Signal, die im Rahmen der Snowden-Enthüllungen zwar einen deutlichen, aber keinen hinreichenden Zuwachs erfuhren – noch oder zu unbedeutend ist, um tatsächlich den von dem Medientheoretiker Geert Lovink geforderten «Massenexodus» von Facebook durchzusetzen.
Dass dies nicht so bleibt, darf nicht Hoffnung, sondern muss Auftrag sein; nicht nur an die Regulatoren – ein #regulatefacebook kann allenfalls der erste Schritt sein – als vor allem an widerständige Innovatoren. Dabei gilt es, nicht nur individuell nach Alternativen zu suchen, sondern sie im Kollektiv zu forcieren. Anstatt sich also kleinkrämerisch auf die Reparatur einer Ruine zu fokussieren oder sich in den Kaskaden der Hashtags zu verlieren, wäre zunächst der Alternativlosigkeit zu widersprechen – und wären neben neuen, wirklich sozialen Netzwerken – Tim Wu, Jura Professor an der Columbia University, regte ein «alt-Facebook» als Nonprofit-Unternehmen an – vor allem eine «dezentralisierte, emanzipatorische Politik» (Evgeny Morozov) einzufordern. Wir benötigen Institutionen, die einerseits den Datenrausch unserer Tage demokratisieren, individuelle Daten schützen und kollektive zur Verfügung stellen – die andererseits aber das Analoge und Digitale zusammendenken, und dabei nicht der diskursiven, digitalen Totalisierung auf den Leim gehen. Es geht also, frei nach Mark Zuckerberg, darum, «Dinge zu zerbrechen» – damit sind nicht zuerst die Datenkonzerne selbst gemeint, sondern vor allem die Denkbarrieren, die uns auf ein Entweder-Oder (Alles oder Nichts, 1 oder 0, analog oder digital, Ja oder Nein zu Facebook etc.) beschränken, und uns letztlich keine Synthese, sondern nur ein amortisierendes Weiter-so unter dem Anschein der Versöhnung verkaufen: Es ist Zeit für die Disruption der Disruption. Was dazu nicht reicht, ist ein Hashtag, mit dem man die Empörung kanalisiert, sich letztlich narkotisiert oder – schlimmer noch; sich weiter zu den «dumb fucks» zählt, für die Mark Zuckerberg seine NutzerInnen hielt.