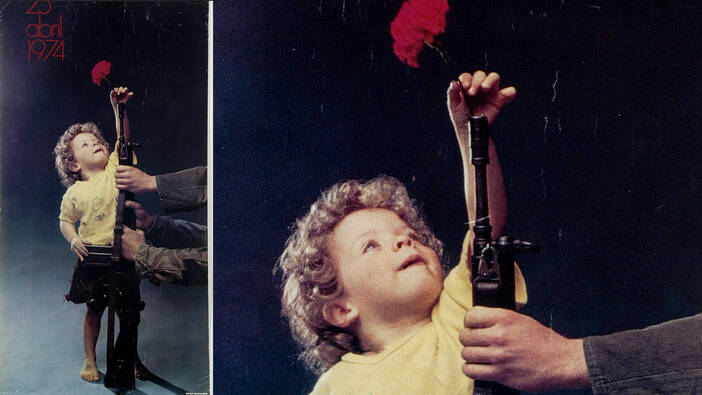Der Konflikt zwischen China und Taiwan nimmt an Schärfe zu. Regelmäßig hören wir von politischen Provokationen, Manövern, Luftraumverletzungen. Dahinter stehen zwei recht unterschiedliche Konflikte, die eng miteinander verschränkt sind: der Souveränitätskonflikt zwischen China und Taiwan sowie der Weltmachtkonflikt zwischen China und den USA.
Jan van Aken ist Referent für internationale Krisen und Konflikte der Rosa-Luxemburg-Stiftung, Linda Peikert freie Journalistin in Berlin. Gemeinsam moderieren sie den Podcast „dis:arm – Friedensgespräche“, dessen neue Folge sich dem Konflikt um Taiwan widmet.
Der Konflikt geht auf den Bürgerkrieg zwischen Kommunisten und Nationalisten zurück. Dieser endete 1949 mit dem Sieg der kommunistischen Truppen unter Mao Zedong, die in Peking einmarschierten und am 1. Oktober die Volksrepublik ausriefen. Die besiegten Nationalisten der Guomindang zogen sich auf die Insel Taiwan zurück. Seitdem regiert die KP China das gesamte Festland, nicht aber auf der Insel.
Aufgrund der Geschichte des Bürgerkriegs betrachteten sich beide Seiten als die einzige legitime Vertretung Chinas. Daher verfolgten Peking und Taipeh das „Ein-China-Prinzip“, demzufolge es nur ein China gibt, zu dem Festland und Insel gehören. Der Dissens lag in der Frage, wer denn die legitime Regierung sei. Am Ende zog die kleine Insel den Kürzeren, Taiwan verlor 1971 seinen Sitz bei den Vereinten Nationen und wird heute von fast keinem Land der Welt mehr diplomatisch anerkannt. Auch Deutschland unterhält dort keine Botschaft, sondern lediglich ein „Deutsches Institut Taipei“.
Trotz der zuwiderlaufenden Ansprüche befinden sich Volksrepublik China und Taiwan in einem recht stabilen Status quo; die wirtschaftlichen und kulturellen Verbindungen sind eng. Diese Stabilität gerät jedoch seit einiger Zeit aufgrund von zwei Entwicklungen ins Wanken: Zum einen entwickelt sich in Taiwan zunehmend eine eigenständige Identität, zum anderen ist China zur wirtschaftlichen Supermacht aufgestiegen, begleitet von einer sehr starken militärischen Aufrüstung. Inzwischen ist China das Land mit den zweithöchsten Rüstungsausgaben weltweit: weit hinter den USA, aber auch weit vor Russland.
Washington versus Peking
Die USA erkannten bereits vor geraumer Zeit, dass ihr Status als alleinige Supermacht nicht von Teheran oder den Taliban infrage gestellt wird, sondern von China. Mit der Wahl von Barack Obama zum US-Präsidenten erfolgte ein pivot to Asia genannter Schwenk in der US-Außenpolitik: weg von Europa und dem Nahen Osten, hin zu Asien. Seitdem steht die Konkurrenz zu China im Mittelpunkt der US-Außenpolitik.
Heute stehen sich zwei hochgerüstete Länder gegenüber, die wirtschaftlich in großer Konkurrenz zueinander stehen. Aufgrund der anhaltenden Dominanz des US-Militärs gibt es zwar (noch) kein militärisches Gleichgewicht; aber da beide Staaten Atommächte sind, scheint ein Krieg zwischen ihnen derzeit wenig wahrscheinlich. Es kann aber, ähnlich wie im Kalten Krieg, zu Stellvertreter-Konflikten kommen.
In der militärischen Konkurrenz hat China einen Nachteil, der bei einem flüchtigen Blick auf die Weltkarte kaum auffällt: Peking hat nämlich keinen ungehinderten Zugriff auf die Tiefsee. Vor der gesamten Küste Chinas liegt eine Inselkette, die einen Bogen spannt von der langen Perlenkette japanischer Inseln im Norden über Taiwan und die philippinischen Inseln bis nach Vietnam. All diese Länder sind mehr oder wenig eng an die USA gebunden.
Chinesische U-Boote können heute kaum bis zur kalifornischen Küste fahren, ohne von der US-Marine bemerkt zu werden, während umgekehrt die USA die chinesische Küste quasi in Sichtweite haben. In dieser militärischen Logik wäre die Kontrolle über Taiwan eine echter Game-Changer für Peking, denn so könnte sowohl eine U-Boot-Flotte mit Zugang zur Tiefsee stationiert als auch die chinesische Verteidigungszone mehrere hundert Kilometer weiter nach Osten verschoben werden.
Der Souveränitätskonflikt
Für die chinesische Führung ist der Anspruch auf Taiwan eng mit der Geschichte Chinas verbunden, von den militärischen Niederlagen in den Opiumkriegen ab 1840 über die teilweise Besetzung durch Japan 1895 bis in den Zweiten Weltkrieg. Diese sogenannte Leidensperiode hat sich bis heute tief ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Vor zwei Jahren veröffentlichte die chinesische Regierung ein sogenanntes White Paper zur Taiwan-Frage. Dort heißt es: „Dass wir bis heute nicht wiedervereinigt sind, ist eine Narbe der chinesischen Nation. Wir Chines*innen auf beiden Seiten sollten zusammenarbeiten, um die Wiedervereinigung zu erreichen und die Wunde zu heilen.“
Eine Wunde, die nur verheilen kann, wenn Taiwan wieder zu China gehört – das ist die Erzählung, die in China vorherrscht. Die Taiwan-Frage gilt also gewissermaßen als Teil der „Leidensperiode“, die überwunden werden muss – da gibt es wenig Spielraum für Kompromisse.
Diese Erzählung ist keineswegs neu, aber sie wird unter Präsident Xi Jinping mit viel größerem Nachdruck verfolgt. Der Autor Stephan Thome, dessen neues Buch über den China-Taiwan-Konflikt („Schmales Gewässer, gefährliche Strömung“) im September im Suhrkamp-Verlag erscheint, führt aus, dass die chinesische Führung in der Vergangenheit dem Prinzip der „strategischen Geduld“ gefolgt sei: Wiedervereinigung ja, aber nicht zwingend innerhalb einer Generation. Xi Jinping dagegen habe unzweideutig formuliert, dass die Wiedervereinigung noch während seiner Amtszeit zustande kommen werde.
Diese Zielbestimmung muss, da sind sich die meisten Expert*innen einig, ernst genommen werden. Ob sie allerdings militärisch verfolgt wird, steht auf einem anderen Blatt. Der deutsche Journalist Felix Lee sieht bislang eher die Lehren des alten chinesischen Strategen Sun Ze am Werk: einkreisen, unterwandern, Lücken füllen, wirtschaftlich einbinden. Denn der beste Krieg, so Sun Ze, sei jener, der gar nicht geführt werden müsse.
Vor 15 Jahren kam China mit dieser Strategie beinahe einen entscheidenden Schritt voran. Damals regierte die KMT, die Partei der Guomindang, in Taipeh, und sie hatte ein Abkommen mit China geschlossen, das auch weitreichende chinesische Investitionen in Taiwan erlaubt hätte. Es fehlte nur noch die Ratifizierung durch das Parlament. Dann entflammte jedoch breiter Widerstand in Taiwan in Gestalt der sogenannten Sonnenblumenbewegung. Letztendlich kam das Abkommen nicht zustande, und die KMT wurde bei der nächsten Wahl abgewählt.
Stephan Thome verweist darauf, dass sich in Taiwan mittlerweile eine eigene Identität entwickelt habe. Es seien zwar fast alle Taiwanes*innen irgendwann einmal vom Festland eingewandert; aber nur weil es historisch einmal zu China gehörte und die Menschen Chinesisch sprechen, sei Taiwan noch lange nicht China. Seit der demokratischen Öffnung Taiwans vor gut 30 Jahren lasse sich eine Art Taiwanisierung beobachten, ein Bewusstsein dafür, dass man sich durch die lange Trennung vom Festland in eine andere, eigene Richtung entwickelt habe. Thome formuliert pointiert: „Taiwan ist so chinesisch, wie Australien britisch ist“.
Ein aufgeladener Souveränitätskonflikt, in dem es auf der einen Seite keine strategische Geduld mehr gibt, während sich auf der anderen Seite eine neue nationale Identität herausbildet: Daraus ergibt sich eine komplexe Gemengelage. Hinzu kommt noch die Überlagerung durch den Weltmachtkonflikt, in dem die eine Seite in einem strategischen Nachteil steckt, der zum Motor militärischer Abenteuer werden könnte.
Unter Expert*innen besteht zwar weitgehend Einigkeit, dass in den kommenden Jahren keine militärische Eskalation zu erwarten ist; bei den mittelfristigen Prognosen gehen die Einschätzungen jedoch auseinander. Die einen betonen eine reale Kriegsgefahr, die anderen gehen davon aus, dass Peking auch künftig an der Sun-Ze-Strategie – in der vielleicht militärisch gedroht, aber nicht angegriffen wird – festhalten werde.
Halbleiter als Friedensstifter?
Zum Zünglein an der Waage könnte die Halbleiterindustrie werden. Rund 90 Prozent der modernsten Mikrochips werden in Taiwan hergestellt, von einer Firma namens TSMC. Die gesamte Weltwirtschaft ist auf diese Lieferungen angewiesen, niemand außerhalb Taiwans kann beispielsweise Chips für die iPhones produzieren. Ob Handys, Rüstung oder industrielle Steuerung: Alle Räder stehen still, wenn TSMC es will. Der Zugriff auf die Chips entscheidet über die wirtschaftliche Konkurrenzfähigkeit von Konzernen und Ländern.
Möglicherweise könnte es genau diese Chipindustrie sein, die einen Krieg zwischen China und Taiwan verhindert. Expert*innen sprechen von einem Silicon Shield, einem Schutzschild aus Mikrochips. Denn diese Fertigungsstraßen können nicht einfach anderswo nachgebaut werden. In Taiwan ist in den letzten drei Jahrzehnten ein Mikrokosmos von Zulieferfirmen entstanden, der extrem viel Detailwissen voraussetzt. Damit wird Taiwan in dieser Branche auf absehbare Zeit über ein Alleinstellungsmerkmal verfügen.
Auf der anderen Seite ist TSMC vollständig abhängig von Zulieferungen aus dem Ausland. Rohstoffe, Maschinen und Chemikalien kommen zu 90 Prozent aus den USA, Japan und der EU. Insofern wäre es keine Option für China, Taiwan zu erobern und selbst die Chipproduktion zu kontrollieren, weil dann alle Lieferungen aus dem Ausland ausblieben.
Wie stark dieser Silicon Shield wirklich ist, darüber gehen die Meinungen auseinander. Fest steht lediglich, dass er nicht ewig halten wird. Denn so einzigartig die Branche in Taiwan auch ist, am Ende ist sie kein Hexenwerk. Sowohl die USA als auch China investieren derzeit hohe Summen in den Aufbau einer eigenen Halbleiterindustrie. Auch wenn es noch ein oder zwei Jahrzehnte dauern mag: Irgendwann wird Taiwan nicht mehr über dieses Alleinstellungsmerkmal verfügen. Damit wiederum würde auch der Silicon Shield entfallen.
Dies unterstreicht: Letztendlich wird viel davon abhängen, ob alle drei Seiten ernsthaft an einer friedlichen Lösung interessiert sind. Sollte dies der Fall sein, wird es – wie in den besten Zeiten der Entspannungspolitik zwischen Ost und West – kooperative Lösungen für das militärstrategische Problem Chinas geben. Solange allerdings der China-Taiwan-Konflikt im Westen nur in militärischen Kategorien gedacht wird, bleibt die Perspektive einer friedlichen Konfliktlösung verstellt.
Aktuell ist die Bereitschaft zu einem Kompromiss indes auf allen Seiten begrenzt. Das liegt daran, dass es nicht zuletzt auch um die Kontrolle des südchinesischen Meeres geht, durch das zwei Drittel des gesamten Welthandels bewegt werden. Wer dieses Meer kontrolliert, kann also viel Druck ausüben – deshalb wird zurzeit mit derart harten Bandagen darum gekämpft.
Dieser Text erschien zuerst in «nd.aktuell» im Rahmen einer Kooperation mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung.