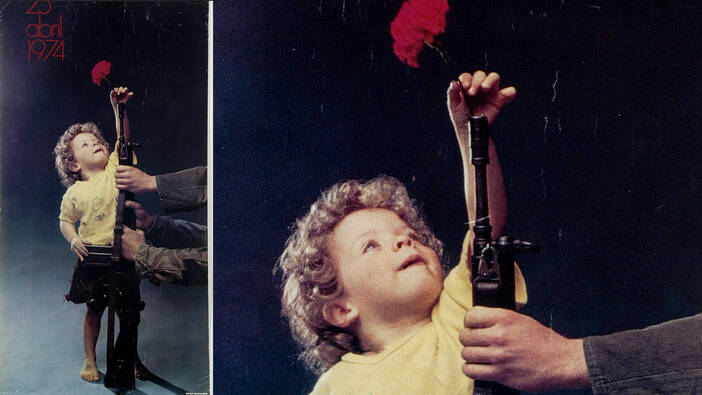Der Ministerpräsident des indischen Bundesstaats Delhi, Arvind Kejriwal, sitzt derzeit wegen Korruptionsvorwürfen im Gefängnis. Dort soll er laut Medienberichten angeblich große Mengen Mangos konsumieren, um seinen Blutzuckerspiegel nach oben zu treiben. Seine Frau Sunita warf auf einer Wahlkampfveranstaltung des Oppositionsbündnisses INDIA (Indische Nationale Allianz für integrative Entwicklung) der Gefängnisleitung vor, ihren Mann umbringen zu wollen, indem sie dem Diabetiker das lebenswichtige Insulin vorenthalte.
Willkommen in Indien: Am 19. April hat in der größten Demokratie der Welt die Wahl begonnen. Diese ist durchaus ein Fest der Demokratie, es geht bunt, laut und aggressiv zu. Allerdings ist auch nicht immer klar, wer die Schurken sind und wer die Helden.
Britta Petersen leitet das Büro der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Neu-Delhi. Zuvor war sie Journalistin, Beraterin in der Entwicklungszusammenarbeit und Senior Fellow beim indischen Think-Tank Observer Research Foundation (ORF).
Wahlberechtigt sind knapp eine Milliarde Menschen. Der populäre Ministerpräsident, Narendra Modi, gibt sich zuversichtlich, dass seine Hindu-nationalistische Bharatiya Janata Partei (BJP) «mehr als 400 Sitze» im Parlament gewinnen wird, also eine Zwei-Drittel-Mehrheit. Doch die indischen Wähler*innen waren schon oft für eine Überraschung gut.
Über anderthalb Monate wird sich der Urnengang hinziehen. Denn um den Prozess zu entzerren, wählen die Bundesstaaten zu unterschiedlichen Zeiten. Die elektronischen Wahlmaschinen müssen teilweise mit Mauleseln und Booten zu den Wahllokalen in abgelegenen Bergregionen oder schwer erreichbaren Dörfern geschafft werden. Erst am 4. Juni wird daher das Ergebnis vorliegen.
Politik in der Kasten- und Klassengesellschaft
Der Prozess ist seit Jahrzehnten eingespielt, doch in diesem Jahr wird die Kritik im In- und Ausland lauter. Wie gesund ist die indische Demokratie, wenn ein populärer Oppositionspolitiker wie Arvind Kejriwal von der Aam Admi Party (etwa: «Partei des kleinen Mannes») kurz vor der Wahl wegen Korruptionsvorwürfen verhaftet wird? Bereits im vergangenen Jahr wurde Oppositionsführer Rahul Gandhi, ein Enkel der ehemaligen Ministerpräsidentin Indira Gandhi, wegen Beleidigung Modis der Sitz im Parlament aberkannt. Seine Verurteilung wurde später vom Obersten Gericht suspendiert; doch nun kämpft Gandhis Kongresspartei damit, dass die Steuerermittlung ihre Konten eingefroren hat – überaus ungünstig in einem Land, in dem die Wahl nach Angaben der US-Denkfabrik Carnegie Endowment noch teuer ist als in den USA.
Der schwedische Think-Tank Varieties of Democracy Institute hat Indien daher in seinem Democracy Report 2024 zu einer «elektoralen Autokratie» herabgestuft: «Viel-Parteien-Wahlen koexistieren mit unzureichenden, grundlegenden Voraussetzungen wie Meinungsfreiheit sowie freien und fairen Wahlen».
Kritische Intellektuelle, wie die bekannte Autorin Arundhati Roy, werde nicht müde zu erklären, dass Indien nunmehr zu einem «kriminellen, Hindu-faschistischen Staat» geworden sei. Doch diese Form von Maximalkritik verkennt, dass Indiens Demokratie schon immer mehr als nur ein bisschen anders funktioniert hat, als die meist im Westen verfassten Lehrbücher voraussetzen.
Das indische politische System ist Ausdruck der bestehenden Kasten- und Klassengesellschaft. Der Aufstieg der BJP markiert einen Bruch mit dem, was Indiens erster Ministerpräsident, Jawaharlal Nehru von der Kongress-Partei, einst «die Idee Indiens» nannte: eine säkulare, multireligiöse und sozialistische Republik. Die Vision der BJP ist hingegen ein Indien, das sich mit dem ursprünglichen Namen Bharat auch seine Geschichte und Religion zurückholt, die durch Jahrhunderte des Kolonialismus unterdrückt wurde. Dieses Indien, so die Vorstellung, nimmt selbstbewusst einen Platz unter den entwickelten Nationen ein und bekennt sich zu seiner ursprünglichen Religion, dem Hinduismus.
Dass diese Vorstellung Nehrus «Idee Indiens» ablösen konnte, liegt auch daran, dass die Kongress-Partei und die verschiedenen linken Parteien stets Projekte der herrschenden oberen Kasten geblieben sind. Das in der Verfassung verankerte Versprechen des Sozialismus im Sinne von Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität wurde nicht eingelöst.
Mahatma Gandhi, die neben Nehru wichtigste Führungsfigur im indischen Unabhängigkeitskampf, war ein Anhänger des Kastenwesens und wollte innerhalb dessen nur die Stellung der «Unberührbaren» (Dalits) verbessern, die er euphemistisch Harijans, Kinder Gottes, nannte. Einzig jene Parteien, die sich explizit als Vertretung der Dalits gegründet haben, stellen die Kastenordnung direkt in Frage. Selbst die im Bundesstaat Kerala regierende Communist Party of India (Marxist) hat bis heute keine*n Dalit im Politbüro. Ihr Generalsekretär, Sitaram Yechury, kommt aus der obersten Kaste, den Brahmanen.
Die Erfolgsformel der Modi-Partei
Die regierende BJP hingegen hat mit Narendra Modi einen Vertreter der Arbeiterkaste (OBC) an die Spitze gebracht. Modis eigene Herkunft aus bescheidenen Verhältnissen ist ein Trumpf, den er regelmäßig gegen die Opposition ausspielt – was einfach ist, denn die Kongress-Partei wird auch fast 80 Jahre nach Indiens Unabhängigkeit von der Brahmanen-Familie Gandhi dominiert, die sich keinen innerparteilichen Wahlen stellen muss.
Kasten und Unterkasten (Jati) sowie Religionsgruppen werden im indischen politischen System als feste Wählergruppen betrachtet, die es en gros zu gewinnen gilt. Vergleiche mit repräsentativen Demokratien, die nach dem Prinzip «one man, one vote» funktionieren, sind daher kompliziert. Denn die BJP verfolgt das Ziel, den Großteil der Hindus für sich zu gewinnen. Damit verfügt sie – anders als etwa das Oppositionsbündnis INDIA, dessen Mitgliedsparteien in verschiedenen Bundesstaaten sehr unterschiedliche Wählergruppen ansprechen – über eine landesweit einheitliche Strategie. Dies ist auch ein Vorteil gegenüber den in Südindien sehr erfolgreichen Regionalparteien. Diese verhindern zwar nach wie vor, dass die BJP in Bundesstaaten wie Tamil Nadu nennenswerte Erfolge feiert, bieten den Wähler*innen aber auf Bundesebene keine Alternative.
Die BJP hingegen macht einem großen Teil der Inder*innen ein Angebot: Großzügige Sozialleistungen für die Armen, Infrastrukturprojekte und ein beachtliches Wirtschaftswachstum von derzeit 8,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für die Mittelklasse und neuerdings auch eine nationalistische Außenpolitik, die der durch den Kolonialismus geschundenen Seele nicht nur der Eliten das wohlige Gefühl vermittelt: Wir sind wieder wer!
Dass die strukturellen Probleme der indischen Wirtschaft, in der nach wie vor 80 Prozent der Menschen im informellen Sektor arbeiten, auf diese Weise nicht gelöst werden, könnte der BJP noch auf die Füße fallen – spätestens wenn eine große Zahl von Menschen merken sollte, dass es wirtschaftlich für sie nicht mehr bergauf geht.
«Nach einem Jahrzehnt mit nahezu beschäftigungslosem Wachstum hat die steigende Zahl entmutigter Arbeitnehmer*innen Indiens Erwerbsquote weit unter das Niveau der vier asiatischen Tigerstaaten gedrückt», so Kunal Kundu, Indien-Ökonom bei der französischen Bank Société Générale. «Dass sich die BJP auf die bestehenden Beschäftigungsmotoren Infrastruktur, Produktion und staatliche Arbeitsplätze konzentriert, die bisher nicht viel bewegt haben, muss umso mehr Besorgnis erregen», warnt der Ökonom. Ohne einen konkreteren Plan laufe Indien Gefahr, den Vorteil seiner jungen Bevölkerung zu verspielen.
Aber Modi hat auch Ämter zu verteilen, und die vergibt er ganz bewusst teilweise an Angehörige der unteren Kasten: Präsidentin ist derzeit Draupadi Murmu, die der besonders marginalisierten Stammesbevölkerung (Adivasi) angehört. Zuvor hatte mit Ram Nath Kovind ein Dalit das oberste Staatsamt inne.
Im Schatten des Hindu-Nationalismus
Muslime hingegen, die mit einer Hindu-nationalistischen Partei naturgemäß wenig anfangen können, aber ein Fünftel der Bevölkerung stellen, gehören nicht zu den potenziellen Wähler*innen der BJP. Sie werden daher links liegen gelassen bzw. gar zum Feindbild aufgebaut.
Professor Sukhadeo Thorat, Vorsitzender des Indischen Instituts für Dalit-Studien, ist der Auffassung, dass Modi und seine BJP die Demokratie in Indien nicht abschaffen wollen. Vielmehr gehe es darum, «die Hindu-Wählerschaft zu konsolidieren» und sich damit eine hegemoniale Stellung im indischen Parteiensystem zu sichern – so wie zuvor die Kongress-Partei, die das Land 54 Jahre lang regierte.
Wie der kürzlich verstorbene Psychoanalytiker Sudhir Kakar gezeigt hat, prägen kulturelle Stereotype, religiöse Identifikation und Kommunalismus die Gefühle indischer Hindus und Muslime seit früher Kindheit. Gewalt wird vor diesem Hintergrund akzeptabel, wenn sie kommunal und religiös sanktioniert ist. Die von Modi kürzlich groß gefeierte Einweihung eines Tempels für den Gott Ram in Ayodhya, die auf den Ruinen der 1992 zerstörten Babri-Moschee errichtet wurde, ist daher ein Symbol nationaler Wiedergeburt. Dass bei den auf die Zerstörung der Moschee folgenden Ausschreitungen schätzungsweise 2.000 Menschen ums Leben kamen, ist in dieser Sicht kaum mehr als eine Fußnote der Geschichte.
Kriminalität und Demokratie gehen in Indien ebenfalls seit jeher Hand in Hand. Milan Vaishnav hat etwa nachgewiesen, dass im Jahr 2014 Gerichtsverfahren gegen mehr als ein Drittel aller Abgeordneten in der Lok Sabha, dem Parlament in Neu-Delhi, liefen, davon mehr als ein Fünftel wegen Kapitalverbrechen. Dennoch stellen indische Parteien diese Abgeordneten auf und Wähler*innen geben ihnen ihre Stimme, sofern sie glaubwürdig den Eindruck vermitteln können, etwas für ihre jeweilige «Community» zu tun – frei nach dem alten Motto: «Er ist ein Schurke, aber er ist unser Schurke.»
Dies hat zur Folge, dass eine große Zahl von Politiker*innen den Ermittlungsbehörden viel Angriffsfläche bietet. Nach einem Bericht der Tageszeitung «Indian Express» sind seit 2014 insgesamt 25 hochrangige Politiker*innen, gegen die Ermittlungen liefen, zur BJP übergetreten – um ihre Haut zu retten.
Es nimmt nicht wunder, dass auch den Inder*innen ihr politisches System manchmal zu chaotisch erscheint – was entsprechende Konsequenzen zeitigt. Nach einer Umfrage des US-Instituts Pew Research Center befürworten 67 Prozent die Aussage: «Ein System, in dem ein starker Führer Entscheidungen ohne Einmischung des Parlaments oder der Gerichte treffen kann, wäre eine gute Form, das Land zu regieren.»
Arvind Kejriwal, dem Geldwäsche in Verbindung mit der Vergabe von Alkohol-Lizenzen vorgeworfen wird, soll übrigens noch bis zum 7. Mai (knapp drei Wochen vor dem Wahltermin in Delhi) in Untersuchungshaft bleiben. Inzwischen wurde ihm im Gefängnis doch noch Insulin zur Verfügung gestellt. Ob Mangos noch auf seiner Speisekarte stehen, ist unbekannt.
Dieser Text erschien zuerst in «nd.aktuell» im Rahmen einer Kooperation mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung.